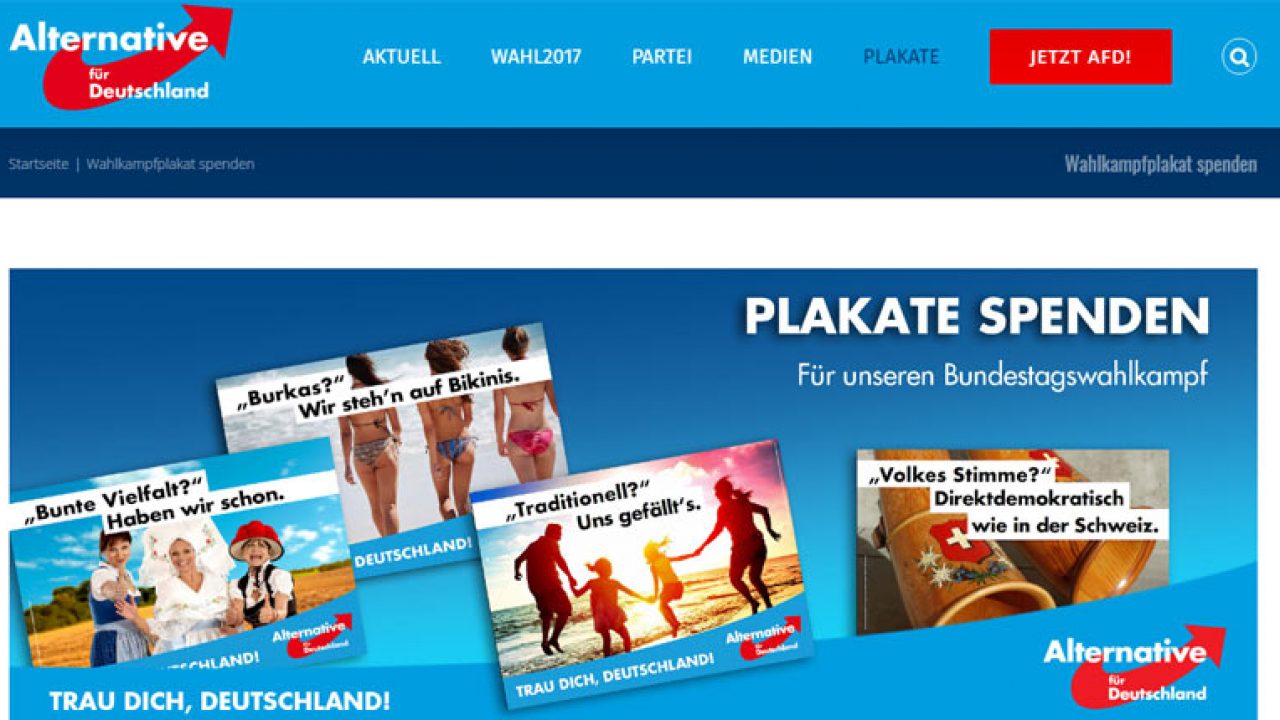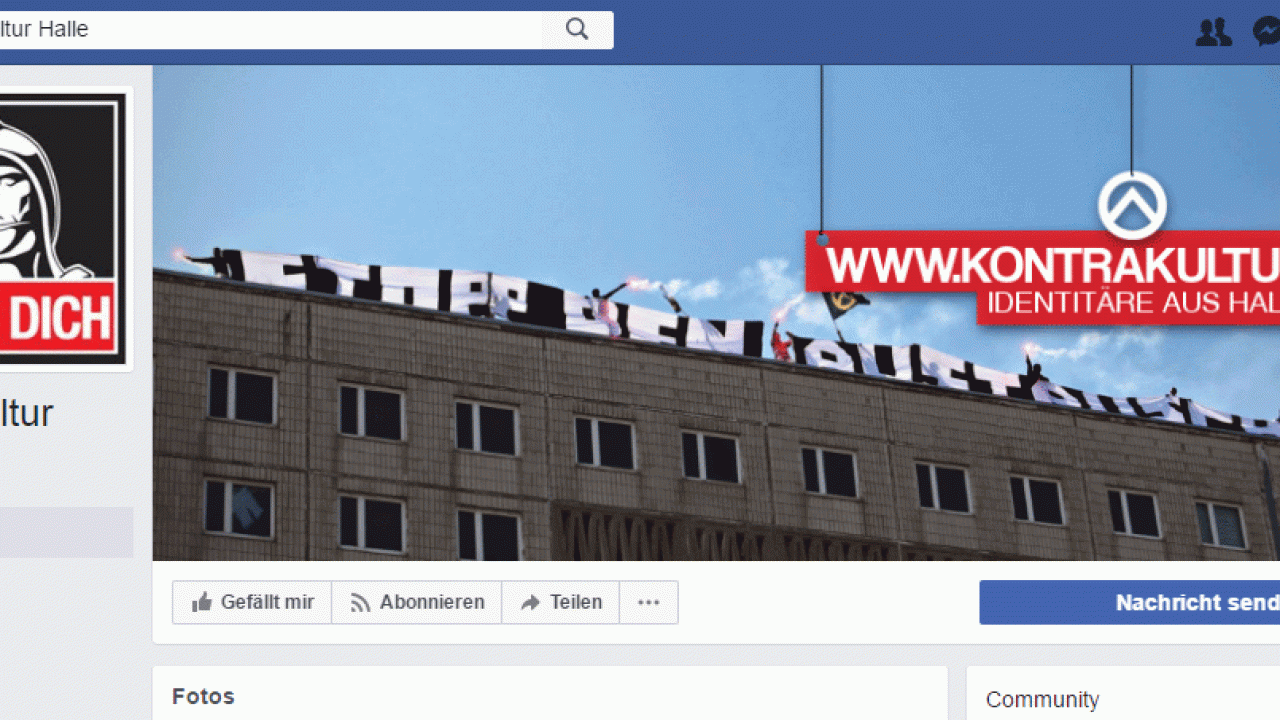Ein Gastbeitrag von Alan Posener
Vor einiger Zeit habe ich an dieser Stelle das Buch „Die Angstmacher“ von Thomas Wagner kritisiert. Wagner zeigte sich besonders beeindruckt – und besonders hilflos – gegenüber den Argumenten der Identitären oder Ethnopluralisten (die Begriffe sind weitgehend synonym), was nicht verwundert, da ähnliche Argumente auch unter „Antiimperialisten“ und linken Globalisierungskritikern verbreitet sind, wie Wagner ja auch selbst betont. Darauf gehe ich noch ein.
„Blutsmäßige“ Homogenität als Voraussetzung der Demokratie?
Wenden wir uns aber zunächst den von Wagner zitierten Ethnopluralisten selbst zu, dem Chefideologenpaar der neuen Rechten, Ellen Kositza und Götz Kubitschek. Im Gespräch mit Wagner (S.80ff) spricht Kubitschek von dem „blutsmäßigen Austausch“, der „an den Rändern“ der jeweiligen Besiedlungsräume der Völker stattgefunden habe, und für die seine Familie „ein gutes Beispiel“ sei. Womit er vermutlich meint, dass der Name Kubitschek (wie übrigens auch Kositza) slawischen Ursprungs ist. Dass jemand aber hier immer noch von „Blut“ und „blutsmäßigem Austausch“ spricht, wenn es um die ethnische Abstammung und Vermischung geht, das ist bemerkenswert.
„Klar ist“, so Kubitschek, „dass jedes Volk auch eine ethnische Größe ist und dass der Verlust dieser relativen Homogenität große Probleme nach sich zieht.“ Mit „ethnischer Größe“ ist eben jene „blutsmäßige“ Homogenität gemeint, für die er und seine Partnerin gerade nicht stehen. Doch nicht nur deshalb ist ist diese Behauptung überhaupt nicht „klar“, ebenso wenig wie Kubitscheks Folgebehauptung: „Bestimmte politische Konzeptionen funktionieren nur, wenn es eine gewisse Homogenität im Volk gibt. Demokratie ist nur möglich, wenn Sie akzeptieren können, dass Sie überstimmt werden. Wenn das, was Sie überstimmt, zu fremd ist, können sie das nicht. Das betrifft beispielsweise die Frage nach unseren Rechtsnormen auf der einen Seite und Scharia-Ansätzen auf der anderen Seite.“
Es ist nicht ganz klar, ob Kubitschek meint, Anhänger der Scharia könnten demokratische Entscheidungen nicht akzeptieren, wenn sie der Scharia widersprechen, oder ob er das Gespenst der Einführung der Scharia in Deutschland per Mehrheitsbeschluss an die Wand malt. Beide Auffassungen offenbaren ein mangelhaftes, ja erschreckendes Verständnis von Demokratie.
Dass bestimmte religiöse Gebote mit gesetzlichen Regelungen in Konflikt geraten, ist nicht neu und nicht beschränkt auf „Fremde“. Die katholische Kirche beispielsweise lehnt die Scheidung und die Abtreibung ab. Katholiken, die sich scheiden lassen, werden vom Abendmahl ausgeschlossen und sind damit der Gnade nicht teilhaftig. Niemand zwingt gläubige Katholiken, die Tatsache zu „akzeptieren“, dass der Staat die Scheidung erlaubt und die Abtreibung zwar verbietet, zugleich aber zulässt. Die Kirche agitiert auch beständig dagegen, und das ist ihr gutes Recht. Für alle wirklich religiösen Menschen gilt der Satz, dass sie „Gott mehr gehorchen (müssen) als den Menschen.“ Radikale Protestanten wie die Quäker und die Zeugen Jehovas leben diesen Grundsatz noch strenger. Damit muss und kann die Demokratie leben.
Wenn aber Kubitschek meint, irgendwann könnte die Scharia per Mehrheitsbeschluss in Deutschland eingeführt werden, so betreibt er entweder demagogische Irreführung oder weiß tatsächlich wenig über die Demokratie. Um die Verfassung im Sinne der Scharia zu ändern, wäre eine Zweidrittelmehrheit nötig. Sie wird es in der absehbaren Zukunft nicht geben. Die Demokratie ist übrigens nicht nur ein System, in dem man „akzeptiert, wenn man überstimmt wird“. Demokratie ohne Rechtsstaat wäre ja einfach die Diktatur der Mehrheit. Demokratie bedeutet, dass die Minderheit – auch die kleinste – alle Rechte genießt, die die Verfassung garantiert, und dass ihr diese Rechte auch nicht per Mehrheitsbeschluss genommen werden können. Dass man dies auf Gut Schnellroda nicht weiß (oder verschweigt), ist erschreckend.
Es ist in der Tat genau andersherum, als von Kubitschek behauptet. Nur der demokratische Rechtsstaat ermöglicht es verschiedenen Gruppen mit verschiedenen Kulturen und Religionen und politischen Prioritäten, friedlich zusammenzuleben.Es ist kein Zufall, dass die älteste Demokratie der Welt, die USA, eben nicht auf einem „blutsmäßig homogenen“ Staatsvolk aufbaut, sondern, wie John F. Kennedy sagte, „a nation of immigrants“ ist. Und obwohl es gewiss in den USA Rassenprobleme gibt, so sind sie nicht Produkte einer mangelnden blutsmäßigen Homogenität, sprich Rassereinheit, sondern der Ausnutzung ethnischer und kultureller Differenzen durch weiße Suprematisten und gewissenlose Demagogen.
Auch Indien, die größte Demokratie der Welt, ist weder ethnisch noch erst recht kulturell homogen, und doch funktioniert diese Demokratie. Die Probleme Indiens werden nicht durch den Mangel an „blutsmäßiger“ Verwandtschaft hervorgerufen, sondern durch religiöse und nationalistische Fanatiker, die aus Differenzen Gegensätze konstruieren, und aus Gegensätzen Unvereinbarkeiten.
Immer schon bildeten die Juden innerhalb ihrer arabischen, persischen, türkischen und europäischen „Wirtsvölker“ (um den rassistischen Begriff zu verwenden, der nur umgedreht als „Gastarbeiter“ wieder auftauchte) eine abgeschottete Gruppe. Das hinderte aber keines dieser Völker daran, sich zur Nation oder zu einem Imperium zu konstituieren, im Gegenteil; allenfalls machten extreme Nationalisten oder hysterische Christen – gelegentlich auch Muslime – ein Problem daraus.
Und so weiter und so fort.
Nun könnte man einwenden, dass Demagogen, Fanatiker, Hysteriker und Extremisten nur dann einen fruchtbaren Boden für ihre Hasspropaganda finden, wenn die „Völker“ eben nicht homogen seien, wie etwa in Bosnien-Herzegowina; deshalb müsse man – leider, leider! – das Ideal der Multikulturalität und Multiethnizität, der Vielfalt und Toleranz, so anziehend es sein möchte, als unrealistisch begraben.
Aber abgesehen davon, dass Kossitza und Kubitschek die Vielfalt innerhalb einer Nation oder eines Imperiums gar nicht anziehend finden und nirgends so argumentieren: Es ist auffällig, dass der Faschismus und der Nationalsozialismus sich nicht etwa in jenen Ländern durchsetzten, denen es an ethnischer Homogenität mangelte, wie in den USA, Großbritannien oder der Schweiz, sondern in relativ abgeschlossenen und ethnisch homogenen Ländern wie Deutschland, Italien und Japan. Im Falle Deutschlands musste man eine winzige und überdies hervorragend integrierte Gruppe zu „blutsmäßig“ Fremden erklären, um die angeblich ausgerechnet durch die 500.000 Juden bedrohte „Reinheit des deutschen Blutes und der deutschen Ehre“ zu schützen.
Auch in Bosnien – wie in ganz Jugoslawien – waren seit dem Zweiten Weltkrieg Ehen zwischen Serben und Kroaten, Muslimen und Christen eher die Regel als die Ausnahme, die „ethnische Homogenität“ ohnehin gegeben (die Albaner einmal beiseitegelassen) – bis die serbischen Nationalisten in den Muslimen plötzlich „Türken“ und in den Kroaten Erzfeinde und Deutschenfreunde entdeckten. Kurzum, die ethnische „Differenz“ ist eine „Différance“, um das Kunstwort von Jacques Derrida zu verwenden: eine künstliche Zuschreibung, kein naturgegebenes Faktum, schon gar nicht ein Fatum.
Wer sind die Vertreter der „Hyperidentität“?
Das Argument, die Demokratie (oder, wie andere sagen: der Sozialstaat) funktioniere nur in einem blutsmäßig homogenen Staat, ist so absurd, dass Kubitschek selbst nicht lange darauf herumreitet. Kositza weicht auf ein anderes Feld aus: „Das Gefühl des Verlusts an Kultur war für uns überhaupt ein Grund, uns als rechts zu empfinden“, behauptet sie. „Mich macht es traurig, wenn Vertrautes, Sprache, Sitte, Feste ihren Charakter verlieren und von sei einer Hyperidentität verdrängt werden.“ Nun gut, das geht vielen so: CSUler lieben den Barock, die Biergärten und die Blasmusik, SPDler trauern nostalgisch Arbeitersiedlungen im Ruhrgebiet, Taubenzüchtervereinen – und der Blasmusik der zechenkapellen – hinterher, und so weiter. Das ist gut konservativ gefühlt, aber, wie das Beispiel SPD zeigt, kein Grund sich „als rechts zu empfinden“ und von blutsmäßiger Homogenität zu schwafeln.
Denn Konservative wissen auch, dass sich „Sprache, Sitte und Feste“ wandeln, wie das Landschaftsbild und die Architektur; nicht wegen einer aufgestülpten „Hyperidentität“, über die noch zu sprechen sein wird, sondern zum Beispiel wegen der Technik. In meiner bayerischen Verwandtschaft fällt es einigen aus meiner Generation schwer, mit mir Hochdeutsch zu reden, und mir also schwer, ihnen zu folgen. Die Enkelkinder sprechen schon untereinander Hochdeutsch, obwohl sie den Dialekt beherrschen. Der Grund für diese Bereicherung ihrer Optionen ist das – deutsche – Fernsehen.
Was „Sitte“ angeht, so mag mancher Reaktionär sich zurücksehnen nach der Zeit, da Frauen ihre „Ehre“ verloren, wenn sie vor der Ehe mit einem Mann schliefen, aber auch da ist nicht die „Hyperidentität“ schuld an der Erweiterung ihrer Optionen, sondern die Pille.
Auch Feste ändern ihren Charakter, nicht weil eine „Hyperidentität“ deren ursprüngliche Bedeutung verdrängt hätte, sondern weil die Menschen anders empfinden, anders glauben, anders feiern: Weihnachten war ein paganes Fest, dann wurde es ein christliches, nun ist es wieder ein semi-paganes; dito Ostern. Dass Ramadan und Halloween hinzugekommen sind, ist eine Erweiterung der Feieroptionen und schränkt niemanden in seiner Freiheit ein, Weihnachten entweder als Konsumorgie oder als Fest der Geburt des Gottessohns – oder beides – zu feiern.
Die Landschaft ändert sich: Fabrikschlote, Kühltürme, Überlandleitungen, Autobahnen, Windräder. Mais verdrängt andere Feldfrüchte, ähnlich wie zuvor die Kartoffel. Im 18. und 19. Jahrhundert wuchs der Wald, bedeckte vorher sandige und warme Flächen und schuf ein völlig neues Ökosystem. Die Städte des Mittelalters brannten nieder und wurden in Stein wieder aufgebaut. Stadtmauern wurden niedergerissen, Verteidigungsgräben zugefüllt und zu Parks umgestaltet. Und so weite rund so fort. Außer dem Wandel ist nichts beständig, und gerade Symbole des Beständigen – wie etwa der Wald – erweisen sich bei näherem Hinsehen als Produkte der Moderne.
Auch das kulturelle Argument ist derart absurd, dass Kositza es bald wieder verlässt, nicht ohne den Hinweis freilich, dass sich Kubitschek „mehrmals in Kamerun“ aufgehalten habe, wo er „das Andere als Anderes wahrgenommen“ habe, „ohne Herablassung oder Geringschätzung“ – ganz anders als andere Touristen, denen – so Kubitschek – „nur eine konsumierbare Folklore vorgesetzt“ wird. Das ist gewiss der Fall; aber kaum besser ist es, „das Andere als Anderes“ unkritisch wahrzunehmen, wenn zu diesem Anderen gehört, dass in Kamerun Hexerei und Homosexualität brutal bestraft werden, wenn der Staat autoritär regiert wird und korrupt ist und die Geburtenziffer 4,7 Kindern pro Frau beträgt, auch deshalb, weil nur 13 Prozent der Frauen und Mädchen Zugang zur Pille haben. Eine gewisse „Geringschätzung“ der Elite dieses zu 70 Prozent christlichen Commonwealth-Landes, die solche Zustände zu verantworten hat, wäre schon an der Tagesordnung, meine ich.
Aber ich bin ja ein „Globalist“ und damit angeblich Vertreter jener „Hyperidentität“, die als „Kosmopolitismus“ von den Stalinisten und als – na, Sie wissen schon – von den Nazis bekämpft wurde. (Für Kubitschek bin ich gar „ein vergifteter Brunnen“. Den „Brunnenvergifter “ hat er sich gerade noch verkniffen.) Am Schluss des Gesprächs mit Thomas Wagner ziehen Kubitschek ihre Trumpfkarte: „Echte Kultur und echtes so-und-nicht-anders-Sein“ sei „nicht verfügbar, nicht konsumierbar“, so Kubitschek nicht „merkantil ausschlachtbar“, so Kositza, widersetze sich dem Drang der „globalen Wirtschaft“, „einheitliche Konsumgewohnheiten“ herzustellen, um „einheitlich produzieren“ zu können.
Linke und Rechte gegen den humanistischen Universalismus
Verzückt hört Thomas Wagner zu. Denn, wie er schreibt: „Die Frontstellung gegen einen zumindest partiell als repressiv empfundenen humanistischen Universalismus verbindet einen Ethnopluralismus, der die Andersheit des Anderen betont, mit dem Begriff der Differenz, wie er in den 70er Jahren … auf Seiten der Linken üblich wurde.“ Darum geht es: Um die „Frontstellung gegen den humanistischen Universalismus“. Um die Verteidigung von Diktatur und Korruption, Homosexuellen- und Hexenverfolgung, Aberglaube und Hass als „Differenz“. Das in der Tat verbindet Teile der Linken, die zu ihrer ewigen Schande ihren universalistischen Anspruch aufgegeben haben, mit der extremen Rechten.
Es ist kein Zufall, dass diese Linke auch anfällig ist für den Antisemitismus, gelten doch die Juden als Erfinde rund Träger des universalistischen Gedankens. Aber das will ich hier nicht weiter ausführen. Wohin freilich diese linke „Frontstellung gegen den humanistischen Universalismus“ führt, will ich an einem Beispiel ausführen, über das ich 2010 in der WELT schrieb. Jasbir Puar – „Queer-Theoretikerin“ und Professorin für Frauen- und Gender-Studien an der Rutgers-Universität in New Jersey – hatte auf einer Konferenz in Berlin einen Vortrag angekündigt: „Beware Israeli Pinkwashing!“ Hintergrund war die Aktion der britischen Gruppe „OutRage“, die für die Rechte sexueller Minderheiten kämpft und auf einer Pro-Palästina-Demonstration die Losung verbreitete: „Israel: Schluss mit der Unterdrückung Palästinas! Palästina: Schluss mit der Unterdrückung von Queers! Schluss mit Ehrenmorden an Frauen und Schwulenmorden in Palästina!“
Was, so sollte man meinen, gut links und gut universalistisch gedacht ist. Es gibt keine guten und schlechten Unterdrücker; man muss überall auf Seiten der Unterdrückten stehen. Das sah (und sieht) Puar anders. Solche Losungen „verwässern die Solidarität mit der Sache Palästinas“, schimpfte sie in der Zeitung „The Guardian“. Der Kampf gegen Israel dürfe „nicht durch eine derart unterkomplexe Haltung unterminiert werden“. Mit anderen Worten: die Identität als Palästinenser ist in der Hierarchie der Unterdrückung wichtiger als die Identität als Schwuler oder als Frau. Pech für die palästinensischen Schwulen, Lesben, Transgender-Menschen, für die Opfer von Ehrenmorden, sexueller und häuslicher Gewalt: Die Ethnie geht vor. Das Blut geht vor. Du bist nichts, dein Volk ist alles. Dahin hat sich die Linke gebracht. Jedenfalls Teile davon.
„I am large. I contain multitudes” (Walt Whitman)
Ich habe Puar zitiert, weil sie ex negativo die entscheidende Frage beleuchtet, die von Identitären und Ethnopluralisten, postkolonialer und „antiimperialistischer“ Linke falsch beantwortet wird. Nämlich worin – oder woraus – meine „Identität“ besteht. Gewiss hat die Ethnie (das verschämte Wort für „Rasse“ ihren Platz, die Nation und ebenso die Kultur. Das zu leugnen hieße die Realität leugnen. Aber weder Rasse noch Nation noch erst recht Kultur müssen die bestimmenden Elemente meiner Identität sein. Die frühen Sozialisten hofften, die Proletarier aller Länder würden erkennen, dass sie gemeinsame Interessen haben, die sie über nationale und kultuzrelle Grenzen hinweg verbinden. Frauen in der ganzen Welt haben gemeinsame Interessen. Schwule und Lesben fühlen sich in Berlin und Tel Aviv zuhause – aber auch arabische Schwule und Lesben eben nicht in Ramallah ode Riad. Im Europa des 16. und 17. Jahrhunderts war die Religion wichtiger als die Nation oder die gemeinsame Sprache und Kultur. Im 14. und 15. Jahrhundert bildeten Gruppen wie die Humanisten übernationale Zirkel, verbunden durch die Liebe zu bestimmten Idealen und die lateinische Sprache. Wissenschaftler in der ganzen Welt kooperieren heute. Viele junge Menschen betrachten sich zuerst als Europäer, dann erst als Angehörige einer bestimmten Nation. Generationen können Identität stiften, man denke an die „68er“ und die „Millenials“.
Es ist geradezu widersinnig, in einem Zeitalter, in dem ich mich per Smartphone mit – sagen wir – einem Blues-Fan in Israel verbinden kann, der mir das Video einer mexikanischen Musikgruppe empfiehlt, das ich mir sofort auf YouTube ansehe, um es dann meinen deutschen Mitmusikern zu empfehlen, einen „Ethnopluralismus“ zu predigen, eine abgeschottete „Identität“, die Vorrang haben soll vor all den anderen Identitätsangeboten meiner Welt. Ich bin Engländer, Anglikaner, Atheist, Halbjude, Deutscher, Ehemann, Vater, Großvater, Journalist, Ex-Lehrer, Ex-Kommunist, Kosmopolit, Intellektueller, Musiker, Beatles-Fan, Linker und noch viel mehr, nicht immer in der Reihenfolge. Der von Linken und Rechten verschmähte humanistische Universalismus gibt mir die Sicherheit, dabei Teil der Menschheit zu sein, die in ihrer ungeheuren Vielfalt nicht daran denkt, sich wieder pressen zu lassen in rassisch oder religiös oder kulturell bestimmte Identitätskästen. Gibt man den Universalismus auf, gibt man das Menschsein auf.
Anmerkung: Aufgrund der berechtigten Kritik eines Kommentators habe ich den Artikel an der betreffenden Stelle überarbeitet.

(Quelle: Alan Posener)
Zuerst veröffentlicht auf www.starke-meinungen.de am 24.01.2017. Mit freundlicher Genehmigung des Autors.