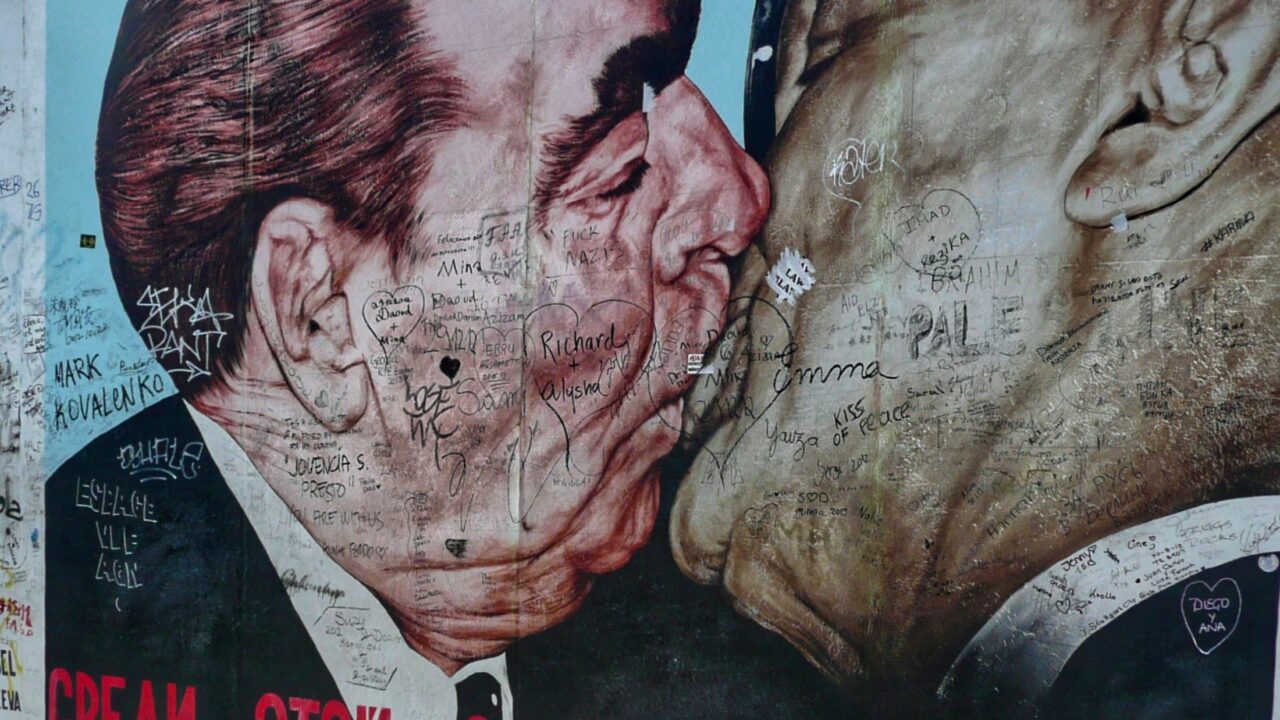
+++ Der folgende Text ist zuerst erschienen im Kulturmanagement Network Magazin August 2023, Ausgabe 173: Ostdeutscher Kulturbetrieb +++
Über Ostdeutschland sprechen, bedeutet oftmals, über die schmerzhaften Transformationserfahrungen der 90er Jahre zu sprechen – vom Ausverkauf der Wirtschaft, Entwertung von Biografien, Entsolidarisierung und Entkollektivisierung. Dafür gibt es gute Gründe. Allerdings werden immer wieder gerade anhand ökonomischer Faktoren antiwestliche Ressentiments, ein generelles Gefühl des Abgehängtseins und auch der Rassismus im Osten erklärt. Dass dies zu kurz greift, ist keine neue Erkenntnis. Vielmehr gilt es über Jahrzehnte gewachsene kulturelle Selbstwahrnehmungen in das Zentrum der Debatte zu stellen, die eben nicht allein mit „Wendeerfahrungen“ zu begründen sind. Geschichtslosigkeit (insbesondere ein Mangel an der Aufarbeitung des NS), Selbstviktimisierung und auch ein Überlegenheitsgefühl vieler Ostdeutscher, finden ihre Ursachen in einer kulturell gewachsenen Projektion auf den Osten, die sich von jeher als Gegenentwurf zum demokratischen Westen verstanden hat.
Ein Blick zurück
Der Literaturwissenschaftler Dirk Oschmann spricht vom „Osten als westdeutsche Erfindung“. Man sollte jedoch den Spieß umdrehen, um eine andere Perspektive auf das Thema sichtbar zu machen: Der Osten hat den Westen als Ursprung und Profiteur der eigenen Probleme ausgemacht.
Diese Art von Externalisierung ist eine Kulturtechnik zur Wahrung der eigenen Identität, der man immer wieder aufs Neue begegnet. Daher lohnt ein Blick zurück in die DDR, der nicht nur die Unangepasstheit und einem oppositionellen Drang vieler Ostdeutscher in den Mittelpunkt der Erzählung stellt: Denn die meisten der DDR-Bürger*innen hatten sich mit dem System arrangiert. Darunter auch viele Künstler*innen, von denen sich die meisten nach Abschluss ihrer Ausbildung auf staatliche Aufträge verlassen konnten. Otto Grotewohls Direktive „Literatur und Bildende Kunst sind der Politik untergeordnet“ ließ zudem im Wesentlichen nur einen staatlich organisierten Kunsthandel zu. Pragmatismus und Opportunismus bestimmten viel mehr die Lebenswirklichkeit der meisten Künstler*innen als offene Opposition und allzu starke Abweichungen von einer Ästhetik des Sozialistischen Realismus. Von dieser Angepasstheit profitierten Staat und Künstler*innen gleichermaßen – ein Arrangement, in dem es sich gut leben ließ.
Viele Menschen richteten sich also im Staatssozialismus ein. Andere stützten seine Repressionen aktiv. Das Argument dafür war naturgemäß nicht die Mangelwirtschaft, die Unfreiheit oder die Korruption. Vielmehr beförderte die Selbstwahrnehmung des Staates eine Projektion, die es auch für seine Bürger*innen erlaubte, sich ideologisch und moralisch auf der besseren Seite des Eisernen Vorhangs zu fühlen. Diese ideologische Überlegenheit entschädigte gewissermaßen für die Entbehrungen im real existierenden Sozialismus und sie hat sich vielerorts bis heute gehalten. Dabei wird im Sinne einer durchgängigen Erzählung fast vergessen, wie abgegriffen und entleert etwa der Ruf nach Solidarität in der DDR von vielen wahrgenommen wurde. Die ritualhaft vorgetragenen Slogans der SED verfingen sich im real existierenden Sozialismus kaum und ihnen wurde nicht selten mit Spott begegnet. Daraus ergibt sich ein Widerspruch. Denn gleichwohl gilt die westliche „Ellenbogengesellschaft“ bis heute als Gegenstück zur vermeintlich solidarischeren DDR und hat sich als Projektion manifestiert.
Die Vorstellung, im solidarischeren Deutschland gelebt zu haben, scheint Teil eines bestimmten ostdeutschen Gefühls geblieben zu sein.Im Sinne einer durchgängigen Erzählung wird fast vergessen, wie abgegriffen und entleert etwa der Ruf nach Solidarität in der DDR von vielen wahrgenommen wurde.
Die real existierende Völkerfreundschaft
Die ausgerufene Solidarität galt zudem nicht für alle gleichermaßen. Einige dieser Geschichten gelangen erst seit den letzten Jahren langsam an die Öffentlichkeit. So sahen sich etwa die ehemaligen sogenannten „Vertragsarbeiter*innen“ mit einem System der rassistischen Politik, nicht minder mit Alltagsrassismus und mit rassistischer Gewalt konfrontiert. Zur Politik gehörte die Unterbringung der Vertragsarbeiter*innen in gesonderten Wohnheimen, Kontaktsperren und Lohnbetrug.
Nach außen proklamierte das SED-Regime „Völkerfreundschaft“. Nach innen ergeben sich nach heutiger Betrachtung frappierende Ähnlichkeiten zur ethnopluralistischen Idee – also jenes rassistischen Prinzips, mit dem heute die Identitäre Bewegung und andere Rechtsextreme sich als „Völkerfreunde“ stilisieren. Allerdings fiel das nur wenigen auf, denn die fast homogene Bevölkerung der DDR war von Rassismus nicht betroffen.
Diskriminierung und Exotisierung von Ausländer*innen blieben so nachhaltig im System verankert. Nach der Wiedervereinigung wurden „die Ausländer “ als Bedrohung im Kampf um alle möglichen Ressourcen ausgemacht. Die Politik reagierte damals mit viel Verständnis für diese Ängste und mit Verschärfungen der Asylgesetzgebung. Diese Erfahrung, dass Gewalt auf der Straße wenig Konsequenzen und noch dazu ein legitimes Mittel zur Durchsetzung völkischer Ideologie sein kann, gehörte auch zur Lernkurve mancher Ostdeutschen.
Die massive Mobilisierung von Rechtsextremen, gerade im Osten Deutschlands, bestimmte die Realität von Schwarzen, People of Color, Obdachlosen und linken Jugendlichen. In den von Neonazis ausgerufenen sogenannten „National befreiten Zonen“ waren diese Gruppen existentiell bedroht, sie wurden geschlagen und ermordet. Eine vielmals schweigende Mehrheit schützte und bagatellisierte den menschenfeindlichen Ausnahmezustand über Jahre, indem weggeschaut wurde und ökonomische Erklärungen für die Gewalt auf den Straßen herhalten mussten. Der Westen als vermeintlich alleiniger Verursacher von Arbeitslosigkeit diente als abstrakter, die gesellschaftlichen Minderheiten als ein konkreter Feind. Die meisten Ostdeutschen betraf das schlicht nicht – auch dies gehörte zu einer ostdeutschen Gemütlichkeit, die die DDR-Gesellschaft als konfliktfreier und harmonischer imaginierte.
Staatlicher „Antizionismus“
Die Idee von der Konfliktbefreiung war darüber hinaus politische Doktrin und Gründungsmythos des DDR-Staats. Unter Beteiligung und Instrumentalisierung von Widerstandskämpfer*innen und Kommunist*innen wurde der Antifaschismus über Nacht zum Leitgedanken einer postnationalistischen Gesellschaft.
Der Dimitroffschen These vom „Faschismus als höchste Form des Finanzkapitalismus“ folgend, schlug das SED-Regime mehrere Fliegen mit einer Klappe. Da die DDR ihrem Selbstverständnis nach antikapitalistisch war, lag das Problem und damit auch die Pflicht zur Aufarbeitung des NS beim Klassenfeind im Westen. Eine ganze postnationalistische Gesellschaft wurde durch diesen ideologischen Kniff aus ihrer Verantwortung entlassen.
Rückblickend betrachtet ergibt sich dadurch noch ein weiteres Problem: Die antikapitalistische Ideologie der Nationalsozialisten wurde schlichtweg verneint und für die eigenen Interessen umgedeutet.
Die Dimitroff-These und ihre Spielarten sind ein Hinweis darauf, weshalb sich in den 1950er Jahren in der antifaschistischen und sozialistischen DDR von Staats wegen ein antisemitischer „Antizionismus“ etablierte. In der frühen DDR äußerte sich dieser durch massive Unterdrückung und wurde vor allem propagandistisch begleitet. Einer der letzten großen Schauprozesse der Stalin-Ära, der Slánsky Prozess, war durch seine offen antisemitische Ausrichtung der Startpunkt für eine Säuberungswelle im gesamten Ostblock. Das Neue Deutschland begleitete den Prozess durch seine Berichterstattung ausführlich.
In der DDR steht der Prozess um Paul Merker und andere Funktionäre für den offenen Antisemitismus. Merker und seinen Mitangeklagten wurdenals „zionistische Agenten“ diffamiert, die die „Ausplünderung Deutschlands“ zugunsten „jüdischer Monopolkapitalisten“ bezweckt hätten. Der Staatssozialismus folgte einer Ideologie, die die Aufteilung der Welt in Gut und Böse proklamierte, strukturell antisemitische Muster bediente und gleichzeitig, etwa durch den Volksbegriff, eine deutschnationale Rhetorik benutzte: „Sich selbst pries die SED als ‚Vortrupp des deutschen Volkes‘ und rief in flammenden Manifesten, alle gesunden ‚Volkskräfte‘ zum ‚nationalen Befreiungskampf‘ zur ‚Befreiung der Nation aus den Klauen des Dollarimperialismus‘ auf: ‚Finanzkapital oder Nation – so steht die Frage‘.“
Selbstredend wurden Restitution und Entschädigung jüdischen Eigentums für die Verbrechen der Shoah, etwa nach dem Beispiel des Luxemburger Abkommens, durch die DDR grundsätzlich abgelehnt. Eine Aufarbeitung der Shoah war demnach durch diverse ideologische Gründe verbaut, nicht zuletzt durch den eigenen Antisemitismus. Den Opfern des Faschismus wurde – abgesehen von kommunistischen Widerstandskämpfern – vor allem generell gedacht. Ein Gedenken, welches die Shoah und damit den Antisemitismus als ihre zentrale ideologisch-kulturelle Voraussetzung in den Mittelpunkt stellt, hätte wohl Fragen nach der postnationalsozialistischen Verfasstheit der DDR-Gesellschaft heraufbeschworen. Eine tiefgehende Beschäftigung mit der Shoah passte schlicht nicht in das Klassenschema.
Selbstviktimisierung und Gegenkultur
Es ist durchaus auffällig, wie wenig diese Aufarbeitungslücke in den Debatten um den Osten im Osten selbst ein Rolle spielt. Auch die Aufarbeitung des Rassismus in der DDR und in der Nachwendezeit wird dort nur von wenigen zivilgesellschaftlichen Akteur*innen sowie von den Betroffenen selbst geführt und trifft immer noch auf viel Abwehr und Beschwichtigung.
Allerdings sind die Kontinuitäten von Rassismus und Antisemitismus in Ostdeutschland besonders zentral, wenn es um eine Herleitung der Ostdeutschen Verhältnisse geht. Die Vorstellung, nicht gehört zu werden und Teil eines marginalisierten Ostens unter westdeutscher Hegemonie zu sein, hat sich bei vielen Menschen manifestiert und ist der Ausdruck einer oftmals kollektivierten Geschichte der Selbstviktimisierung in mehreren Etappen: Erst war man Opfer Hitlers, danach Opfer der Stasi und nun Opfer des Westens. Diese übergreifende Opferstilisierung relativiert zuerst den Nationalsozialismus. Eine kollektive Aneignung spezifischer Opfererfahrungen relativiert auch diese. Rechte Akteure der DDR-Aufarbeitung, darunter Vertreter des Dresdner Hanna Arendt Instituts, der Gedenkstätte Hohenschönhausen oder der Union der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft, verliehen dieser Relativierung einen Schub. Beispielsweise analogisierte Hubertus Knabe, Leiter der Gedenkstätte Hohenschönhausen, den NS- mit dem DDR-Staat „als zwei ‚sozialistische‘ Seiten einer totalitären Medaille“.
Aber diese häufige Selbstviktimisierung der Ostdeutschen hat noch mindestens zwei andere Seiten. Einerseits wird so Raum für eine Externaliserung der eigenen Konflikte bereitet. Andererseits halten diese oftmals generalisierten Opfererzählungen die Voraussetzung für eine spezifische Projektion auf den Osten bereit. Selbstviktimisierung und Ostdeutschsein können so aneinander gebunden werden.
Die Projektion auf den Osten – als Gegenbild zu einer komplexen, modernen Welt – hat in Deutschland eine lange Tradition. So wurden die meisten antimodernen politischen Bestrebungen und Ideologien in Deutschland über eine emotionale Nähe zum Osten propagiert. Der Osten ist dabei nicht rein geografisch zu verstehen. Vielmehr steht er für die Haltung einer kulturellen „Volksgemeinschaft“, die typische antimoderne Elemente wie Authentizität, Natürlichkeit und Ursprünglichkeit aufruft. Die Projektion auf den Osten beflügelte und beflügelt identitäre, völkische, rechts- und linksrevolutionäre Fantasien und bringt antiwestliche Schwärmer*innen und Ideolog*innen zusammen. Heute gilt der Osten Deutschlands zunehmend als Gegenbild zur alten Bundesrepublik. Er ist zu einer Chiffre geworden, die eine Gegenkultur zum Ausdruck bringt, in der der Osten einigen als deutscheres Deutschland gilt und manch anderen als das solidarischere.
Stimmen des Ostens
In den öffentlichen Debatten haben sich Stimmen etabliert, die ganz spezielle Diskurse für die Auseinandersetzung um Ostdeutschland instrumentalisieren. In einem Beitrag für Die Zeit stellte Thomas Oberender – damals Intendant der Berliner Festspiele – die Frage, warum die AfD in Ostdeutschland so viel Zuspruch erfährt. Seine Antwort: Den Ostdeutschen wurden ihre Identität und ihre Lebensgeschichte durch einen „innerdeutschen Kolonialismus“ geraubt. Im Kunst- und Kulturfeld ist des Öfteren die Rede von einem durch den Westen usurpierten Osten. Daher wird auch hier ein postkolonialer Diskurs über die Nachwendezeit gefordert. Hierbei handelt es sich um einen weiteren problematischen Aspekt der Generalisierung und damit auch der Einebnung von Geschichte. Die Aufarbeitung der deutschen Kolonialvergangenheit hat gerade erst begonnen und wurde selbstredend nicht für eine ostdeutsche Identitätsfindung erkämpft. Gleichwohl soll von der Aufmerksamkeit um den dringend notwendigen Diskus über die tatsächliche Kolonialgeschichte Deutschlands auch ein ostdeutsches Opfernarrativ profitieren.
Dass notwendige gesellschaftliche Debatten von einer ostdeutschen Perspektive gekapert werden, konnte man auch an der Diskussion um das sogenannte Ost-Erwachen beobachten. Dieser Begriff wurde von der Soziologin Naika Foroutan im Jahr 2018 ins Spiel gebracht. Foroutan formulierte damals ihre These von der Vergleichbarkeit der Abwertungserfahrungen ostdeutscher und muslimischer Personen. Diese These passte hervorragend zur ostdeutschen Selbstviktimisierung. Aus Foroutans Idee, einer Allianz von marginalisierten Gruppen, wurde in der Folge eine nahezu reine Debatte um das Befinden der Ostdeutschen.
Während im Westen der Rassismus in den Hinterzimmern stattfände, artikuliere er sich im Osten auf der Straße und wäre auch immer gegen das System gerichtet, gab erst kürzlich die Autorin Jana Hensel dem Deutschlandfunk preis. Damit bemühte sie auch hier die Figur eines zwar impulsiveren, aber auch authentischerem Ostens, der sein Anliegen wenigstens direkt adressiere, während der Westen im Verborgenen und somit eigentlich unehrlich agiere.
An anderer Stelle, einer 2019 stattgefunden Veranstaltung mit dem Titel „Im Osten geht die Sonne auf“, strickte Hensel einen kausalen Zusammenhang zwischen den „Wende“-Erfahrungen der Ostdeutschen und den rassistischen Pogromen der 90er Jahre. „Die Zeit-Journalistin sprach davon, dass sich in Ostdeutschland seit den 1990ern der Fremdenhass ‚eingenistet‘ habe, gerade so, als ob es sich um ein dort bis dahin völlig unbekanntes Phänomen gehandelt habe.“20 Damit ist die Debatte um Ostdeutschland seit langem an einem Punkt angelangt, der sich auch im Kunstfeld etabliert hat. Der Westen wird zum Verursacher der eigenen Probleme erklärt.
Kulturelle Kontinuitäten in den Blick nehmen
Nicht allein im Osten, überhaupt reüssiert im Kunstfeld ein dichotomes Weltbild, welches die Welt in Gut und Böse einteilt. Die Begleitmusik handelt so gut wie immer von Solidarität, Widerstand, von Volk und Identität.
Wenn man so möchte, ist auch dies das vermeintlich Progressive am Ost-deutschsein. Dieses Selbstverständnis wird auch durch einige ostdeutsche Kulturakteur*innen getragen. Die Selbstbeschreibung Uwe Tellkamps als „indigener Dresdner“ ist dazu das Passstück von rechts. Ostdeutschsein ist in einigen Kreisen zu einer identitären Chiffre und zu einer antiwestlichen Gegenkultur geworden.
Nicht zuletzt deshalb liegt es auch bei den Kunst-und Kulturinstitutionen im Osten, diese und andere Erzählungen kritisch zu hinterfragen. Vermehrt Persönlichkeiten in ihre Programme zu integrieren, die ausgeprägte Sensoren für die kulturelle Funktion von Entlastungserzählungen, Feindbildkonstruktionen und Gruppenzugehörigkeit der Mehrheitsgesellschaft haben, kann dabei ein Weg sein. Einige Selbstgewissheiten des Kulturfelds kämen dadurch ins Wanken und würden im besten Fall auch in Selbstkritik münden. Beispielhaft wären gut gemeinte und vermeintlich progressive Neubesetzungen von Stichwörtern wie „Heimat“ oder „Ostdeutschsein“ unter diesen Bedingungen schwer denkbar. Vielmehr würde über die Anschlussfähigkeit dieser Begriffe für identitäre Kulturpolitiken gesprochen.
Ebenso muss diese Erkenntnis viel stärker in die kulturelle Debatte um den Osten und damit in die Programme der Kulturinstitutionen einfließen. Zu anschlussfähig ist etwa die Erzählung von einem authentischen und idealistischen Osten als Gegenstück zum materialistischen Westen. Eine Identifikationsfigur die links wie rechts wirkt. Eine weitere wäre die Stilisierung der Ostdeutschen zu einer Minderheit, die sich in eine Reihe mit kolonialisierten Völkern und Menschen mit Migrationsgeschichte stellt. Räume für Erzählungen über die Ungerechtigkeiten sowie realen und gefühlten Verletzungen in den herausfordernden Nachwendejahren wären dadurch nicht abgeschafft. Und darüber hinaus müssten die bis heute wirkenden Kontinuitäten von Antisemitismus, Rassismus und Autoritarismus viel stärker in den Blick genommen werden. Das kann dann gelingen, wenn es bei den Debatten um den Osten mehr um Kultur und nicht, wie es die AfD vormacht, um Identität geht.
Wandelbarkeit aber auch die Fähigkeit zur Selbstkritik und Aufarbeitung, das Entwickeln von Alternativen und eine Wehrhaftigkeit gegen eben jene, die genau diese Errungenschaften abschaffen wollen, erfordern viel Aufwand und manchmal unangenehme Entscheidungen. Kunst- und Kulturinstitutionen sind nicht nur Plattform für diese Prozesse. Ihre Haltung und ihr eigenes Handeln sind maßgeblich für das Gelingen einer demokratischen Kultur.
Leon Kahane und Fabian Bechtle sind bildende Künstler und leiten das Forum demokratische Kultur zeitgenössische Kunst (Forum DCCA), ein Projekt der Amadeu Antonio Stiftung. Das Forum ist ein Ort für künstlerische Kulturkritik. Es produziert in Kooperation mit Kulturinstitutionen künstlerische Beiträge und Begleitprogramme, die sich mit aktuellen gesellschaftspolitischen Debatten sowie kulturellen Kontinuitäten von Antisemitismus und Rassismus auseinandersetzen.


