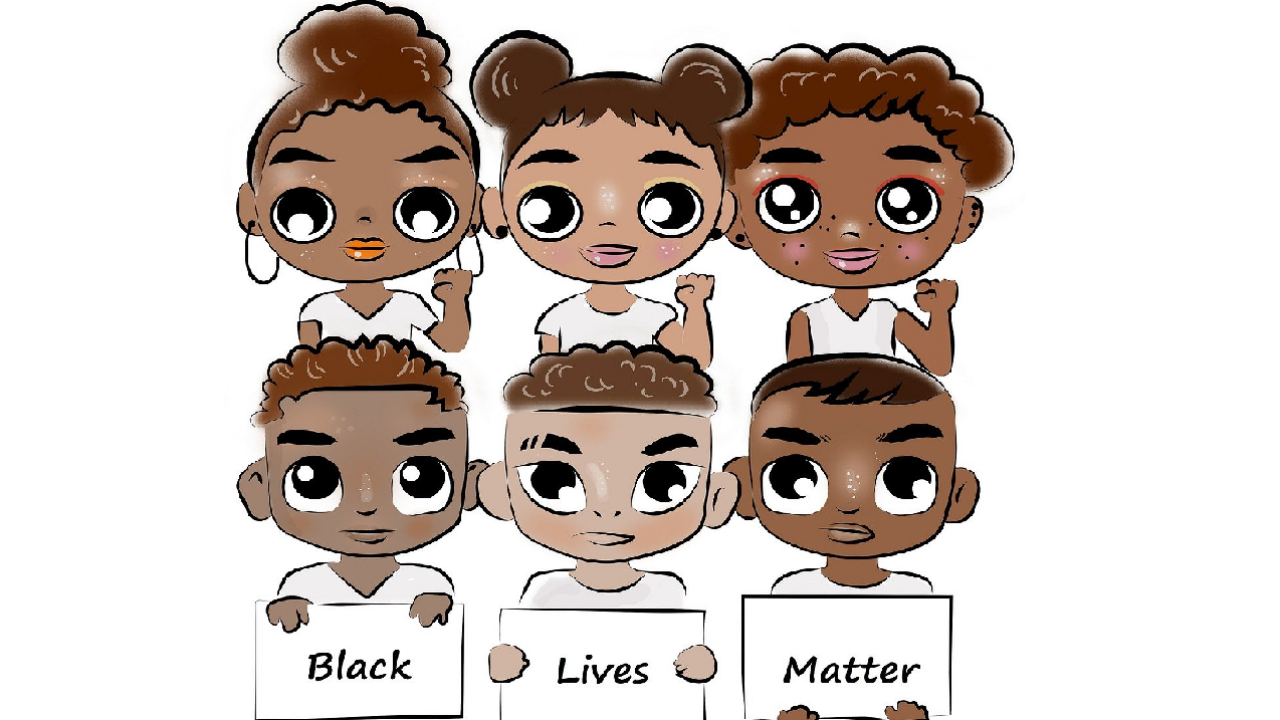Die 19-jährige Maite, die Semitistik an der FU studiert, war wohl eine der jüngsten Teilnehmerinnen an der Konferenz. Sie sei hauptsächlich wegen der verschiedenen Geschichten “von anderen Frauen, die entweder nach Deutschland gekommen sind oder hier geboren sind, aber eben rassistische Erfahrungen gemacht haben” gekommen. Die Geschichten hätten sie sehr bewegt, sagte sie nach der letzten Podiumsdiskussion am Sonntagabend. Auch das Thema Rassismus in Deutschland sei für Maite sehr wichtig, da sie auch schon aufgrund ihrer Hautfarbe diskriminiert wurde. Bis vor Kurzem habe sie damit noch nicht wirklich umgehen können, da sie in Stuttgart in einem sehr weißen Umfeld geboren und aufgewachsen sei, in dem fast niemand ihre Erfahrungen und Gefühle nachvollziehen konnte. Seit Maite in Berlin ist, “gibt es viel mehr Möglichkeiten andere Menschen zu finden, die die gleichen Erfahrungen gemacht haben. Das ist eben schön zu hören, wie die damit umgegangen sind oder wie sie damit umgehen und wie man seine eigene Identität stärken kann”.
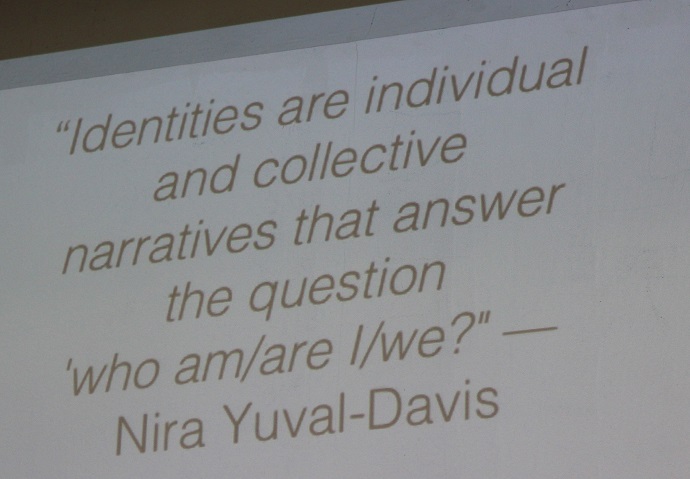
Der International Women Space (IWS) bezeichnet sich selbst als “eine feministische politische Gruppe, die gegen die alltägliche Gewalt, Rassismus, Sexismus, Patriarchat und alle Arten von Diskriminierung kämpft.” Der IWS besteht mittlerweile seit fast fünf Jahren und setzt sich aus Migrantinnen, geflüchteten Frauen und Nicht-Migrantinnen zusammen. Im Dezember 2012 entstand er aus der Besetzung einer Schule in Berlin-Kreuzberg durch Geflüchtete. Dort wurde ein Raum ausschließlich für Frauen geschaffen, der es ermöglichte, die Verbindungen von Rassismus und Sexismus sichtbar zu machen. Der IWS verfolgt seither das Ziel, historische und aktuelle Geschichten von Widerstand durch Frauen zu erzählen. Er fordert für Frauen das Recht, aufgrund geschlechtsspezifischer Verfolgung Asyl zu bekommen. Um dies zu erreichen, werden Demonstrationen, Vorträge und Treffen mit anderen Frauen und Organisationen veranstaltet.
Ziele der Konferenz am 28. und 29.10.2017 waren nun der Austausch und die Vernetzung der von Rassismus betroffenen Frauen unterschiedlicher Generationen und mit unterschiedlichen Migrationserfahrungen. Auch ging es um den historischen Zusammenhang und die Verknüpfung von Rassismus und Sexismus. Vor allem aber sollte auch der Widerstand thematisiert werden, den diese Frauen aus allen Generationen leisteten und leisten – Widerstand gegen systematische Unterdrückung am Arbeitsplatz, in der Gesellschaft und durch den Staat.
Rassismus in den 1990er Jahren in Ost und West
In der Podiumsdiskussion zum Thema “Rassismus & rassistische Gewalt in Deutschland von den 90er Jahren bis heute” machte die Moderatorin, Ceren Türkmen, gleich zu Beginn deutlich, “dass es nicht DEN Rassismus und Sexismus gibt, sondern wir vielmehr von verschiedenen Rassismen und Sexismen sprechen sollten.” Schließlich würden verschiedene Frauen mit verschiedenen Migrationsgeschichten ganz unterschiedliche Erfahrungen mit Rassismus und Sexismus machen. Den Fragen, was eigentlich in den 90er Jahren in Deutschland passiert ist, und wie wir heute diese tödliche rassistische Gewalt analysieren können, stellten sich drei Aktivistinnen: Peggy Piesche, Bafta Sarbo und Aurora Rodonò.
Die Perspektive auf Rassismus in Ostdeutschland gab Peggy Piesche, die in der DDR geboren und sozialisiert wurde. In dem selbsternannten antifaschistischen Staat wurde gesagt, Rassismus gäbe es nur im Westen. Alltagsrassismus, den Peggy in ihrer Jugend in Thüringen durchaus erlebte, konnte nicht versprachlicht werden, weil es ihn offiziell nicht gab. Durch diese Sprachlosigkeit, wie sie es nennt, war auch die Selbstbezeichnung schwierig. Erst nach der Wende fand sie die richtigen Worte, um die eigene Identität zu versprachlichen. In “ADEFRA e.V. – Schwarze Frauen in Deutschland” fand Peggy ein Kollektiv, über das sie sich nun definieren konnte. Und mit der Entdeckung der Begriffe ‘afrodeutsch’ und ‘schwarze Deutsche’ war der Sprachlosigkeit über die eigene Identität ein Ende gesetzt.
Ria Cheatom, eine der Gründerinnen von ADEFRA, erzählt, wie befreiend es für sie war, sich als afrodeutsch bezeichnen zu können. “Ich habe sie stehen lassen mit dem Wort und das war meine Waffe. Das war Widerstand.”
Dass weder in den 1990ern noch heute Rassismus ein Problem “frustrierter Ostdeutscher, die mit der Wiedervereinigung nicht umgehen konnten”, war bzw. ist, machte Bafta Sarbo deutlich. Bafta wurde in Frankfurt als Tochter von geflüchteten Oromo geboren, lebt nun in Berlin und ist Vorstand der “Initiative Schwarze Menschen in Deutschland” (ISD Bund).
In den 90ern gab es einige Parteien wie die DVU oder Die Republikaner, die es durch rassistische Diskurse über Geflüchtete und Migrant_innen in deutsche Landesparlamente oder sogar das Europaparlament schafften, erzählte Bafta und fügte hinzu: “Das kommt uns vielleicht ein bisschen bekannt vor”. Weiter erinnerte sie an die sich häufenden rassistischen Pogrome gegen Geflüchtete in Westdeutschland. Mölln, Solingen, Lübeck – Schlagwörter die zeigten, dass rassistische Gewalt bei weitem kein rein ostdeutsches Problem ist. Gleichzeitig gab es “größere bürgerliche Solidarisierungskampagnen […], aber auch Widerstand von Migrant*innen”. Die Politik antwortete darauf mit einer Asylrechtsverschärfung, die das Grundrecht auf Asyl praktisch abschafften. Darauf ging auch Peggy ein und zog eine Parallele zwischen dem sogenannten Asylrechtskompromiss 1993 als Reaktion auf Hoyerswerda und Co. und der mehr oder weniger konkreten Festlegung einer Obergrenze in diesem Jahr – nach vermehrter Gewalt gegen Flüchtlingsheime, Geflüchtete und Helfer_innen. Anstatt systemischen Rassismus zu thematisieren und zu bekämpfen, reagierte die Politik – damals wie heute – also mit Maßnahmen, die das Grundrecht fliehender Menschen auf Asyl teilweise massiv beschneidet.
Bafta betonte, dass die rassistische Gewalt in den 90er Jahren nicht von irgendwoher käme und es deshalb eigentlich auch wichtig sei, “über rassistische Gewalt in den 80er Jahren in Westdeutschland zu sprechen, um die Kontinuitäten aufzuzeigen und zu zeigen, dass die Wiedervereinigung zwar wahrscheinlich ein wichtiger Krisenfaktor war, der rassistische Gewalt auch begünstigt hat, [dass die rassistischen Diskurse und vor allem die rassistische Gewalt] in Westdeutschland aber vor allem auch in den 80er Jahren schon begonnen hat.”
Der NSU-Komplex und was wir daraus (nicht) gelernt haben
Auch Aurora Rodonò vom Tribunal “NSU-Komplex auflösen” sprach davon, dass “das rassistische und ignorante Klima in Deutschland, explizit gestützt seit den 80er Jahren durch Presse, Wissenschaft und Politik” die rassistische Gewalt, damit auch den NSU, erst ermöglichte. Sie erzählte, dass bereits Anfang der 80er Jahre der Begriff ‘Das Boot ist voll’ geprägt wurde, als Rückkehrprämien für Gastarbeiter_innen eingeführt wurden. Anschließend verdichtete sich die Gewalt gegen Migrant_innen und Geflüchtete. “Es gab Brandanschläge und der rassistische Mob ging auf die Straße. Das NSU-Trio hat sich in der Zeit von Rostock-Lichtenhagen, Mölln, Solingen, Lübeck oder Hoyerswerda radikalisiert.”

Aurora Rodonò: „Immer wieder gab es Widerstand und Solidarität, immer schon gab es Menschen, die sich engagierten, sich verbündeten mit Kämpfen, sprachen und handelten gegen den Rassismus und damit sagten: ‘Uns gibt es. Wir sind hier’“
Doch ähnlich wie Bafta bekräftigte Aurora auch die Erinnerung an Widerstand und Solidarität. So zum Beispiel an die Familie von Halit Yozgat, dem mutmaßlich letzten und jüngsten Opfer des NSU, die zusammen mit der Initiative “6. April” (dem Tag, an dem Halit im Jahr 2006 ermordet wurde) gegen Rassismus kämpft.
Dieser Widerstand würde jedoch auf einem “gesellschaftlichen, einem staatlichen Terrain […] leise gedreht”, sagte Moderatorin Ceren Türkmen. Anders als beispielsweise die schwarzen Frauen in der DDR gäbe es doch heute eine Sprache und ein Wissen. Wie könne es dann sein, “dass wir nach dem NSU-Komplex nach wie vor mit einer Situation zu tun haben, die eben zu einem Zulauf zur AfD, zu einem Zulauf auch zum Rassismus in der Mitte der Gesellschaft” führt? Der NSU und der Umgang mit ihm zeige deutlich: Es gibt eine Geschichte und eine Systematik des Rassismus.
“Deutsch, ABER mit Migrationshintergrund”
Unter diesem Titel diskutierten Stefanie-Lahya Aukongo, eine schwarze, intersektionelle Künstlerin und Tülin Duman, Queer- und Menschenrechtsaktivistin und Mitinhaberin des Berliner Veranstaltungsortes Südblock, moderiert von Clementine Ewokolo Burnley.
Die Moderatorin erklärte, dass diese ‘Aber’ immer an Deutsche angehängt wird, “die in Frage gestellt werden sollen.” Tülin führte aus, dass heutzutage anscheinend “deutsch” nicht mehr ausreiche. Da gäbe es die “deutsch-Deutschen” oder “bio-Deutschen” auf der einen Seite, die sich von der anderen Seite abgrenzen wollen, den Personen mit Migrationshintergrund, -geschichte oder -erfahrung.
Tülin Duman: “Wieso überhaupt so viel über Deutsch sein gesprochen wird, was das überhaupt ist? Das frage ich mich auch die ganze Zeit…”
Auch die Bezeichnungen aus den vergangenen Jahrzehnten, “ausländische Arbeitskräfte”, “ausländische Arbeitnehmer”, “Gastarbeiter”, “ausländische Mitbürger” und schließlich in den 2000er Jahren etabliert und bis heute anhaltend die Bezeichnung: “deutsch mit migrantischem Hintergrund”, zeigten die Veränderungen und dadurch gleichzeitig die Absurdität von Fremdbezeichnungen. Die Differenzierungen die mittlerweile zwischen Migrant_innen und Geflüchteten gemacht werden – schon lange hier oder gerade erst angekommen, gebildet oder nicht, muslimisch oder christlich – führten auch zu Abgrenzungen untereinander. Nicht wenige würden sich auf ihren Bildungsstand, Beruf oder ihre Kunst beziehen und sagen: “‘Ich bin zwar eine Migrantin oder Zugezogene aber ich bin anders.’ Und das ist genau das, was die Mehrheitsgesellschaft fast tagtäglich provoziert und auch fördert, ein gewisses Konkurrenzverhalten untereinander.”
Tülin rief jedoch dazu auf, statt sich voneinander abzugrenzen, sich zu verbünden. Nicht etwa “gegen künstlich kreierte Feinde”, aber mit dem Ziel, ein Leben in Würde zu führen, Respekt zu genießen und “nicht tagtäglich attackiert, diskriminiert und ausgegrenzt [zu] werden.” Daher sei es vielleicht auch nicht schlecht, dieses “Aber” zu unterstreichen und darüber zusammenzukommen.
Lahya hingegen meinte, dass es vielleicht nicht “‘Deutsch, aber’ sondern ‘Deutsch und’” Migrationshintergrund heißen sollte. “Mein vermeintlicher Migrationshintergrund ist eigentlich mein Vordergrund und diesen Vordergrund möchte ich erheben und auf den möchte ich stolz sein”.

Lahya: “Ich bin oft so die Projektionsfläche ihrer romantisierten, exotisierten Wahrnehmung aus ihrer kolonialen Perspektive.”