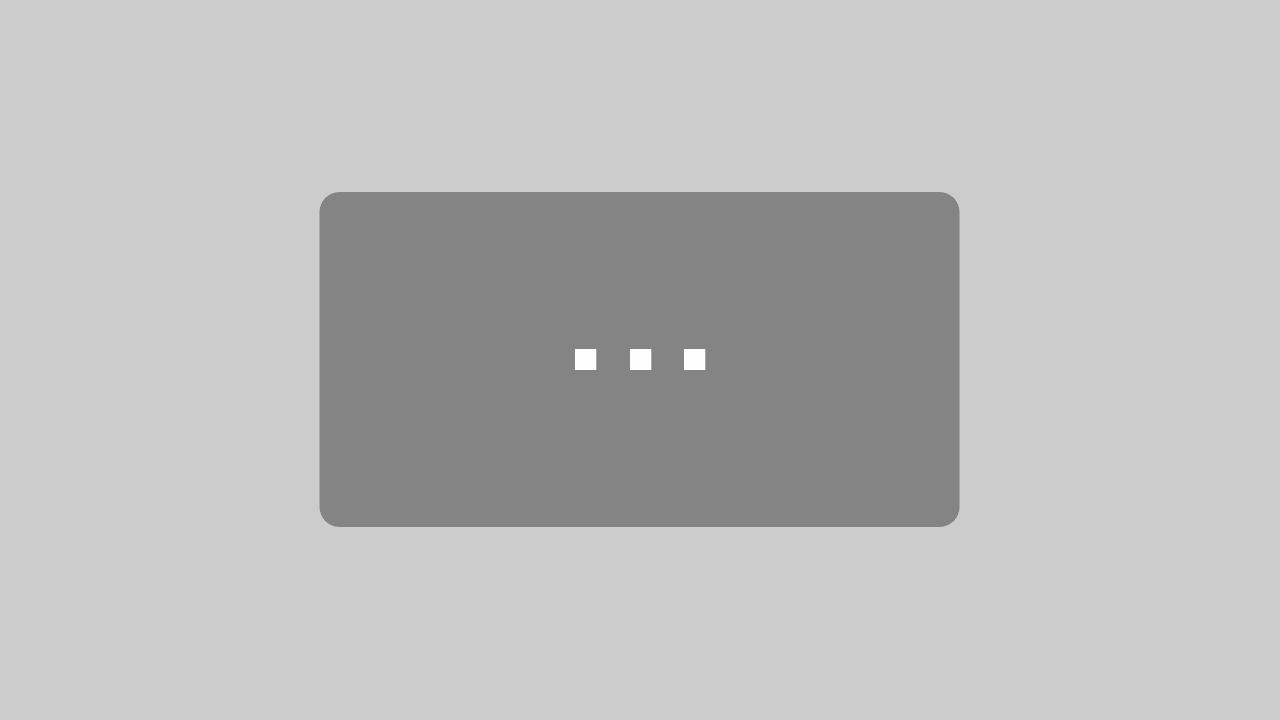Als Kind spürte Michel Friedman die sprachlose Angst seiner nach Paris und dann nach Deutschland übersiedelten polnisch-jüdischen Eltern. Auch hier waren sie Fremde, Staatenlose, die Angst blieb. Täglich.
„Ich bin auf einem Friedhof geboren. Schmerz, der kein Ende kennt. Über-Lebende. Trauernde.“ Mit diesen Worten eröffnet Friedman seine Erinnerungen. Nun spürt er eine grenzenlose Angst, die er zeitlebens verdrängen musste, um überhaupt leidlich „gesund“ aufwachsen zu können:
„Meine Mutter ist gestorben, vor Angst. Kein Augenblick ohne Angst.“ Diese Angst erwuchs aus „diesem Ort“, Auschwitz. Mutter nimmt „Tabletten, gegen die Angst. Erfolglos. Gegen die Erinnerung. Erfolglos.“ Sein Vater, der abends stundenlang die FAZ liest, obwohl er nur rudimentär deutsch versteht, möchte in dem ihm fremden Land stark und mutig sein, sich behaupten unter den Deutschen:
„Ihm fehlen die Worte. Ihm fehlt die Sprache. Deutsch bleibt fremd. Papa liest / die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Jetzt: jeden Abend, drei Stunden.“
Sein Vater hat „trotzdem Angst. Albträume. Nimmt keine Tabletten, weil Mama schon welche nimmt.“
Sechsjährig ist Michel psychosomatisch schwer krank, atemlos: „Einmal im Monat schreie ich nach Luft. Ersticke. Liege im Bett, hohes Fieber. Im Gedächtnis bis heute: das Ersticken, die Todesangst.“
Ihr Status als Staatenlose, der erst in Michels 19. Lebensjahr endet, macht die Friedmans zu Bittstellern in Paris, aber vor allem später in Deutschland: „Ich bin in Paris geboren. Mein erster Ausweis: von den UN. Staatenloser Flüchtlingspass.“
Hiermit fühlt sich Michel Friedman „den“ Türken, Griechen, den Roma verbunden. Ausstoßungsprozesse von der Mehrheitsgesellschaft nimmt er schon früh wahr. Sich gegen sie zu wenden wird für ihn später, als einflussreicher Publizist, zu einer Selbstverständlichkeit, einer inneren Verpflichtung. Als Überlebende bleiben seine Eltern und er selbst „Alleingebliebene. Zerfetzte. Seelenfriedhöfe. Voller Trauer und Schuldgefühle. Überleben heißt Schmerz. Leben heißt Schmerz.“
Zufluchtsorte: Bücher
Michel, der Französisch als Kleinkind und danach auch Deutsch lernt, muss für seine polnischen Eltern übersetzen, als sie von Grenzbeamten befragt werden: „Sie können nur schwer antworten. Das Kind kann für sie antworten. Sie, die aus Polen gekommen sind, haben nur wenige Worte gelernt.“
Michel sucht Fluchtorte. Mit Zehn entdeckt er im verdunkelten Wohnzimmer in Paris die Literatur: „Bücher, meine Wunderwelt. Meine Traumwelt. Meine Fluchtwelt.“ Das Lesen ist für Michel ein Schutzraum „vor einer feindlichen Welt. Bis heute. Und Musik.“
Als sie nach Deutschland übersiedeln, Michel ist zehn, fahren sie dennoch jedes Wochenende zurück nach Paris. Seine Großmutter verweigerte die Übersiedlung nach Deutschland, in das „Mörderland“. Worum seine Eltern ins Land der Mörder und Zuschauer übersiedeln, darüber wird innerfamiliär nie wirklich gesprochen: „Warum in das Land der Mörder? Darauf nie eine Antwort von euch. Nicht einmal ausgewichen seid ihr. Keine Lügen, keine Märchengeschichten, nur Schweigen.“
Es folgen unzählige Versuche seiner Eltern, bei den Deutschen anzukommen, sich zu „integrieren“. Ihr Sohn Michel soll am Alltagsleben der deutschen Kinder Teil haben. Gemeinsam geht seine Mutter mit ihm Eis essen – und doch ist die familiäre Trauer auch hierbei allgegenwärtig:
„Ich wollte nicht, dass sie weinte, schon wieder weinte. Wie immer weinte. Ich wollte nicht, dass sie mein erstes Eis-Essen mit ihren Tränen verdarb. Genauso schnell, wie sie weinte, lächelte sie wieder.“ Es ist ein Prozess der De-Realisierung, um die Abspaltung der tiefen Traumata aufrecht zu erhalten.
Oskar Schindler, der Retter
Und dann gab es Oskar Schindler, der seine Eltern auf die lebensrettende Liste schrieb und auch später bei Familienfesten häufig dabei war. Oskar Schindler war mittels seiner „Scheinfabrik“ der Retter seiner Eltern und von 1200 weiteren Juden. Seine Eltern blieben freundschaftlich mit ihm verbunden, als Schindler von 1965 – 1974 in einer unscheinbaren Einzimmerwohnung gegenüber dem Frankfurter Bahnhof wohnte – sowie parallel hierzu auch in Israel, wo Hunderte der von ihm Geretteten lebten. Und ohne Oskar Schindler, der sogar bei Michel Friedmans Bar Mitzwa in Tel Aviv dabei war, wäre Michel nicht geboren worden, dessen war sich Friedman immer sehr bewusst: „ Er rettete meine Eltern und meine Großmutter. Stolz, dass ich diesen Mann kennen durfte. Ich habe viel von ihm gelernt. Das Wichtigste, was ich von ihm gelernt habe, ist: „Es gibt keine Entschuldigung, nicht zu handeln, sich nicht einzumischen.“ Und ich empfinde für ihn auch eine große Portion Liebe. Er ist einer meiner Herzensmenschen, weil er so vielschichtig und nicht nur ein Held war, weil er nicht nur das große Vorbild war, sondern weil es da auch Schattenseiten gab. Einem Kind und Jugendlichen tut es gut, wenn jemand, den man liebt, nicht nur gut und perfekt ist“, erzählte Friedman 2019 in einem Interview.
Es war vor allem das Vorbild Oskar Schindlers, das Michel Friedman, so betont er immer wieder, zu seinem leidenschaftlichen, lebenslangen Kampf für die Demokratie ermutigte, auch innerhalb seiner jüdischen Gemeinschaft.
Kampf um die „Integration“
Auch Friedmans Vater, dem die Bildung durch Auschwitz vorenthalten wurde, versucht sich mühsam, mit äußerster Kraftanstrengung, in Deutschland zu „integrieren“. Zuerst versucht dieser es mit einer äußerlichen Anpassung an die bürgerliche Gesellschaft: „Was Papa kann: Auto fahren. Elegant sein. Verantwortlich sein. Fleißig sein. Arbeiten. Schuften. Tanzen.“ Was er jedoch nicht könne: „Lachen. Reden. Einfach so reden. Hören. Ein kaputtes Ohr. Zertrümmert vom Gewehrkolben eines Deutschen, in der dunklen Zeit.“
Sein Vater möchte kein Mitleid haben, er möchte Teil der deutschen Mehrheitsgesellschaft werden, deren Regeln verstehen: „Morgens um sechs gut riechen. Papa im Bad. Mama und das Kind im Bett. Das Kind beobachtet.“ Das ist eine sehr andere Realität, als sie seine Eltern in Auschwitz durchlebten. Diese grausame Vergangenheit möchte sein Vater abschütteln, vergessen: „Papas Hände, voller Parfum, bedecken das Gesicht. Glücksmoment, Papas Glücksmoment. Armer Papa. Hat gestunken, im Ghetto.“ Michel möchte, wie die meisten Kinder unglücklicher Eltern, diese glücklich machen, aufheitern – ein Bemühen, das Jahrzehnte später oft zu schweren Depressionen führt. Es benötigt sehr viel seelische Kraft, die eigenen Eltern aus der Trauer, der Depression zu „retten“.
Trauer und Auschwitz
Als Kind spürte Michel Friedman die abgrundtiefe Auschwitz-Trauer seiner Eltern, deren grausamsten Erlebnisse in Auschwitz. Als Erwachsener verschiebt er einen Besuch bei seinem Vater immer wieder, zu groß sind Angst und Schuldgefühle: „Will nicht, dass du siehst, wie ich weine. Um dich, Papa. Um Mama. Um euer Leben im Ghetto.“ Er weiß um die Systematik der Versuche der Deutschen, die Identität der Juden, deren Würde, zuerst systematisch zu zerstören, auszulöschen, um sie danach in Asche zu verbrennen: „Vergessen. Sie schlugen zu. Wieder und wieder. Jagden dich. (…) Eure Heimat war euch mit Nummern eingraviert. Dort gehörtet ihr hin. Das war euer neues Zuhause.“
Auschwitz war bewusste, sadistische Freude der Deutschen an der Zerstörung, die sie zu Hunderttausenden, Millionen genossen: „Du fällst mit seinem Gesicht / auf den nassen Asphalt. „Typisch Jud!“, schreien sie. „Nichts kann er, der Jud.““
Immer wieder spürt der Sohn die unermessliche Trauer seiner Eltern, die durchlebten Misshandlungen, Entwürdigungen: „Sie, Friedhöfe der Erinnerungen, der Schatten und der Geister. Sie, die gesehen haben, was Hölle ist.“
Die Ängste der Eltern
Die Ängste seiner Eltern brachen immer wieder durch: „“Fahrradfahren ist gefährlich“, sagt Papa. „Du kannst dich verletzen.“ „Du kannst stürzen.“ „Du kannst überfahren werden.“ „Du kannst sterben.““ Und weitere Ängste der überlebenden Eltern, dem Wiederholungszwang ihrer Traumata geschuldet: „“Du darfst dich nicht erkälten“, sagt Mama.“ „Das ist gefährlich“, sagt Mama. „Frieren ist gefährlicher als schwitzen“, sagt Mama.“
Und an anderer Stelle im Buch verwandelt Friedman sein Fremd-Sein und seine innere Verpflichtung, seine Eltern, die Shoah-Überlebenden, „aufzuheitern“, zum Leben zu erwecken, sie von den Toten zu befreien, in diese lyrische Zeile:
„Staatenloses Kind. Migranten-Kind. Juden-Kind. Lebensaufgabe dieser Kinder: Eltern glücklich machen. Eltern stolz machen.“
In der Pubertät, am Frankfurter Gymnasium, werden die Noten Michels irgendwann schlecht. Zuerst verheimlicht er dies, bis der Blaue Brief der Schule bei seinen Eltern eintrifft. Der Lehrer offenbart seinen überraschten Eltern, dass ihr Sohn Michel noch eine gewisse Chance hat, versetzt zu werden: Nachprüfungen, in jedem Fach. 21 Tage hat er noch Zeit zum Lernen, bis zu den Prüfungsterminen. Nun erwacht der Kampfgeist, der Selbstbehauptungswillen in seinem Vater. Sein Sohn Michel dürfe nicht aufgeben: „“Leben ist Weitermachen, sonst nichts“, sagt Papa.“
Sein Vater, mit seinen bescheidenen Deutschkenntnissen, Betreiber eines Pelzgeschäftes, handelt entschlossen: „Papa schließt sein Pelzgeschäft – einundzwanzig Tage. Sitzt neben mir – drei Wochen lang. Ich lerne, Papa kann nicht helfen, nur sitzen. Hat zu wenig gelernt. Hitler kam zu früh, schloss seine Schule. Papa sitzt da, Papa schaut mir zu. Ich lerne.“
Die Scham und die Selbstverletzungen
Michel Friedman schreibt, auch im Ringen mit dem – aufgenötigten – Schamgefühl und der inneren Angst, in sehr direkter Weise über sein kindliches selbstverletzendes Verhalten, über seine frühen, ererbten Todeswünsche: „Das Kind hat keine Fingernägel, schon lange nicht mehr. Angeknabbert, aufgefressen, abgekratzt. Das Nagelbett blutig, die Gewebeweichteile entzündet, eitrig, geschwollen. Zerstörung. Selbstzerstörung. Selbstverstümmelung.“ Er habe, so sagte er in einem Interview mit der taz, auch erwogen, das Buch unter einem Pseudonym zu veröffentlichen, auch zum Selbstschutz. Aber das erschien ihm, dies spürte er im langen, quälenden Schreibprozess an Fremd, als höchst fragwürdig, die Wirklichkeit zu sehr verdeckend. „Ich muss zugeben: Ich habe große Angst vor der Veröffentlichung“, sagte Friedman der taz in besagtem Interview. Er, der souveräne Redner und Moderator, möchte nun zu dem Zerstörerischen stehen, das die Deutschen seinen Eltern und damit auch ihm selbst, der elf Jahre nach der Shoah geboren wurde, angetan haben – exemplarisch für die meisten Juden. Er vermag zu schreiben, dieser Verpflichtung ist er sich bewusst. Und er möchte wohl auch, öffentlich, in Deutschland seinen Eltern danken, die ihm viel mitgegeben haben – mehr, als sie für sich selbst zu „nehmen“ vermochten. „Mich haben sie dann auf Händen getragen, zum Wissen, zum Lernen. Mein Vater sagte immer wieder: Sie können dir alles nehmen, nur nicht das, was du im Kopf hast“, so Friedman.
Der deutsche Pass
Erst als Michel Friedman 18 ist erhält er den deutschen Pass, hat nun eine gewisse Sicherheit, und doch: „und jetzt offiziell Deutscher. Schüttelfrost. Lebensmittelpunkt: Deutschland. Schüttelfrost. Zukunft: Deutschland. Schüttelfrost. Nächte nicht geschlafen. Das Kind wollte weg. Sehr weit weg. Nie verstanden, warum seine Eltern hier leben.“
Dann eine, selbst organisierte, Verlockung für den jungen Mann, den 18-Jährigen: Das Visum ist da, für New York; das Land der Freiheit, der Demokratie. Nichts wie weg aus Deutschland, dem Land der Täter: „Große, weite Welt.“ Er erzählt hiervon begeistert am Esstisch, erwartet Zustimmung, Freude. Das Gegenteil ist der Fall: „Schweigen. Sekunden, die ihm vorkommen wie Ewigkeit. Mutter sagt mit leiser Stimme: „Willst du uns allein lassen? Willst du uns umbringen?“
Ein kurzes Nachdenken, die Loyalität, die Angst um die Eltern ist stärker als der Wunsch nach der Freiheit: Jetzt Blitzentscheidung: Das Kind zerreißt das Visum. Es bleibt. Es wird Deutscher.“
Der zweifache Tod – „Das Kind, es lebt“
Den Tod seiner Eltern erlebt Michel Friedman als eine abgrundtiefe Verlassenheit, über die er sehr direkt schreibt. Der Wunsch, sich mittels Tabletten – „Das große Kind hat schon lange Tabletten gesammelt“ – das Leben zu nehmen, ist übermächtig. Erst Jahrzehnte später findet er Worte hierfür. Und noch so vieles mehr.
Ein großartiges Werk!
Gut dass es nicht unter einem Pseudonym erschienen ist.
Michel Friedman: Fremd. Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin/München 2022, 168 S., 20 Euro.