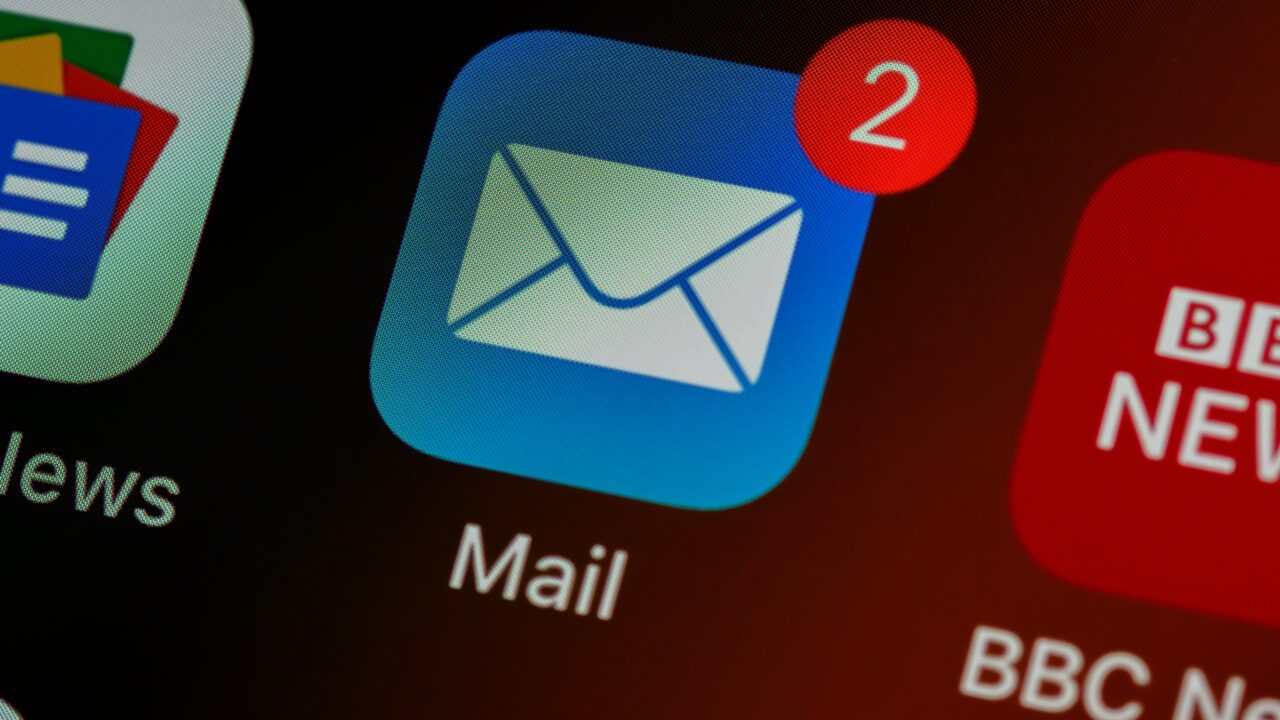Im Delphi Filmpalast in Berlin wurde am 2. Februar 2020 der Film „Aus dem Nichts“ gezeigt. Ursprünglich wollte der Film auf die Betroffenenperspektive bezüglich der Anschlagsserie des „NSU“ aufmerksam machen – nun erfährt er neue Aktualität. Ein Teil der Einnahmen des Abends wurde daher an den Opferfonds CURA weitergereicht, der Betroffene rechtsextremer Gewalt finanziell unterstützt.
Täter-Opfer-Umkehr
„Aus dem Nichts“ erzählt die Geschichte von Katja Şekerci, die bei einem Nagelbombenanschlag ihren deutsch-kurdischen Mann und ihren Sohn verliert. Die Ermittlungen der Polizei gehen zügig in die Richtung von Bandenkriminalität und suchen die Täter*innen im migrantischen Umfeld von Katjas Mann, Nuri. Auch die Medien vermuten keine rassistischen Motive hinter dem Anschlag – stattdessen wird auf die kriminelle Geschichte und den Migrationshintergrund des Opfers hingewiesen. Selbst Katjas Mutter schließt einen rechtsextremen Hintergrund des Anschlags aus und bezieht sich dabei auf Nuris kriminelle Vergangenheit. Schnell wird klar, dass Rassismus kein alleiniges Problem des rechtsextremen Spektrums ist, sondern sich durch die gesamte Gesellschaft zieht.
Genau dieses Schema der Täter-Opfer-Umkehr war in den „NSU“-Ermittlungen präsent. Ein Überlebender des „NSU“-Nagelbombenanschlags in der Kölner Keupstraße berichtete, die Ermittler*innen hätten ihn „wie einen Schuldigen“ behandelt. Auch im Zusammenhang mit dem Anschlag in Hanau wird die Frage gestellt, wieso sich die Opfer überhaupt am Ort des Anschlags aufgehalten hätten, schließlich müsse der Täter den Ort doch aus manifesten Gründen ausgesucht haben. Etwa, weil er sich durch die Shishabars gestört gefühlt habe. Rainer Rahn, Spitzenkandidat der AfD zur hessischen Landtagswahl 2018, bediente dieses rassistische Narrativ. Shishabars seien „Orte, die vielen missfallen, mir übrigens auch“. Die Schuld sucht er offenbar nicht in erster Linie beim Täter: „Wenn jemand permanent von so einer Einrichtung gestört wird, könnte das irgendwie auch zu einer solchen Tat beitragen“.
Auch in den Ermittlungsbehörden ist ein solches Denken keine Ausnahme. Einrichtungen, die sich für Betroffenenhilfe engagieren, berichten von Fragen wie, ‘wieso hielten Sie sich dort auf?’ in Vernehmungssituationen mit Betroffenen rassistischer Gewalt bei der Polizei. Trotzdem bespielen Verantwortliche oftmals die Mär vom Einzelfall. Auch die Einteilung in Absicht oder Versehen sollte hier keine Rolle spielen dürfen, denn das Ergebnis ist für Betroffene von Rassismus dasselbe: sie werden von den Ermittlungsbehörden nicht hinreichend ernst genommen und laufen Gefahr, selbst ins Visier der Ermittlungen zu geraten. Dabei sollten diese Institutionen doch auch Menschen zur Seite stehen, die von rassistischer Gewalt betroffen sind. Eigentlich sollten sie Einrichtungen sein, an die sich Menschen mit Diskriminierungserfahrungen vertrauensvoll wenden können. Die Realität sieht leider anders aus. Wirksame Strategien gegen strukturellen Rassismus in Behörden gibt es trotz jahrelangem zivilgesellschaftlichem Engagement bis heute nicht.
Die Frage von Recht und Gerechtigkeit
Im weiteren Verlauf des Films von Fatih Akin findet der Gerichtsprozess statt, der die Schuld der Angeklagten Rechtsextremen offenbart und trotzdem wegen nicht hinreichender Beweislage mit einem Freispruch endet. Durch diese offensichtliche Ungerechtigkeit wird die Frage der Differenz von Recht und Gerechtigkeit umgangen. Zudem entfernt sich der Film von der Geschichte der „NSU“-Prozesse – jahrelange, erfolglose Ermittlungsarbeit in die Richtung der Betroffenen statt der rechtsextremen Täter*innen wird ausgeblendet. Stattdessen wird die Frustration der Angehörigen im Schnelldurchlauf erreicht und die politische Dimension der Tat gerät in den Hintergrund.
Die Frustration und die Ausweglosigkeit aus den Auswirkungen des Nazi-Terrors auf ihr Leben kulminieren im Schlussteil in einem Selbstmordanschlag der Protagonistin auf die Mörder*innen ihrer Familie. Sie findet sie im Umfeld der rechtsextremen Partei „goldene Morgenröte“ in Griechenland. Während die internationale Vernetzung des rechtsextremen Spektrums eine große reale Gefahr darstellt, wird die reale Unterstützer*innenszene des rechtsextremen Terrors in Deutschland durch ihre Nicht-Darstellung verharmlost. Allerdings hat der Film nicht den Anspruch, reale Umstände des Rechtsextremismus in Deutschland abzubilden. Es geht vielmehr um die Identifikation mit Betroffenen rechten Terrors im Angesicht von rassistischer Diskriminierung durch Ermittlungs- und Justizbehörden, durch die eigene Familie und die Presse. Es geht um Schmerz, Zorn und Ausweglosigkeit. Dass hierbei die politischen Tatmotive und die Realität rechtsextremer Strukturen in Deutschland in den Hintergrund geraten, ist schade, aber vertretbar.
Denn was der Film auch an seinem Ende leistet, ist eine eindrucksvolle Darstellung der zahlreichen Steine, die Betroffenen von rechtsextremer Gewalt von verschiedenen Akteur*innen in den Weg gelegt werden und welcher Schmerz durch rechtsextremen Terror und den unsensiblen Umgang damit entsteht. Wie viel mehr und größere Steine eine Protagonistin mit Migrationshintergrund hätte überwinden müssen, bleibt offen. Auch die Frage nach wirksamen Strategien gegen Rechtsextremismus wird nicht beantwortet – über acht Jahre nach der Enttarnung des „NSU“ hat weder die Gesellschaft noch die Politik eine geeignete Antwort darauf gefunden. Diese Tatenlosigkeit klagt der Film aus betroffener Perspektive an und hat damit keinen Zipfel seiner Aktualität eingebüßt. Denn unterdessen illustrieren die weiteren rechtsextremen Anschläge in Halle, Hanau, Kassel und weiteren Orten und die aufgedeckten rechtsextremen Terrorgruppen die Dringlichkeit einer handfesten Strategie gegen Rechtsextremismus.