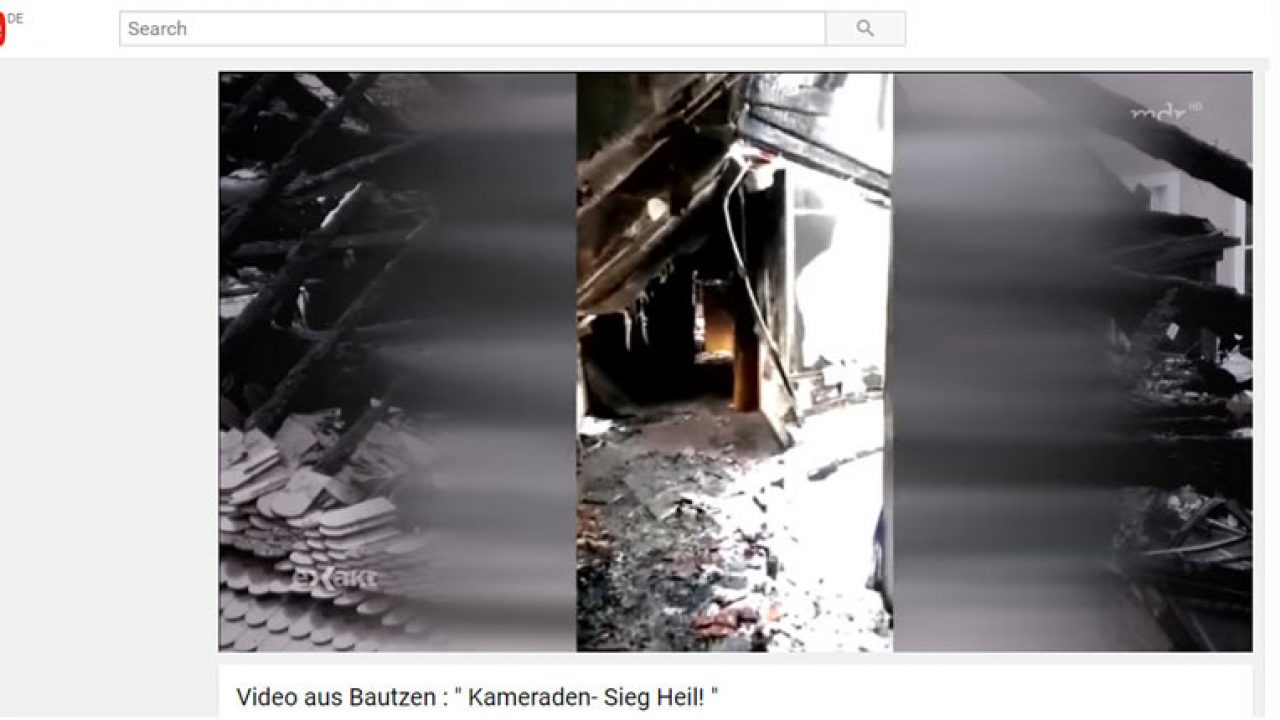Es ist der 25. Juni 2014. Eine große Menge hat sich vor einem behangenen Straßenschild im nördlichen Teil der Kohlentwiete im Stadtteil Hamburg-Altona versammelt. „Die Tasköpüstraße ist eine Mahnung und Aufforderung, Verantwortung wahrzunehmen und für ein respektvolles und friedliches Zusammenleben einzutreten“, erklärt Hamburgs (damalige) Kultursenatorin Barbara Kisseler. Es ist ein besonderer Tag für die Eltern von Süleyman Tasköprü: 13 Jahre nach der brutalen Ermordung ihres Sohnes durch den NSU wird im Gedenken an ihn und den brutalen, rassistischen Mord eine Straße nach ihm benannt. Der Initiator der Straßenumbenennung, Yusuf Uzundag, Bezirksabgeordneter der Grünen Hamburg-Altona, ist stolz auf sein Engagement. Mit der Straßenumbenennung wurde sein Ziel, ein Zeichen gegen rechten Terror zu setzen, erreicht. Doch was so selbstverständlich wirkt, war ein schwieriger Weg.
Hamburg: Umbenennung vonseiten der Bevölkerung nicht erwünscht
Bereits 2012 forderte Uzundag die Umbenennung der Schützenstraße, in der der Mord an Süleyman Tasköprü begangen wurde. Während die Familie des NSU-Opfers sofort einverstanden war, begann innerhalb der Bevölkerung und vonseiten der SPD der Protest. Mit der Begründung, zu viele Firmen seien dort angesiedelt und die Straße sei viel zu stark bewohnt, trat man seiner Forderung entgegen. Zudem wurde die Umbenennung der Straße aufgrund eines Gesetzes negiert, welches die Umbenennung einer historischen Straße nicht möglich macht. Dass dies jedoch möglich war, beweist die Umbenennung einer Hamburger Straße in Werner-Otto-Straße im August 2013. Die Behördengänge aufgrund der Straßenumbenennung und der allgemeine Verwaltungsaufwand waren weitere Argumentationsstränge. Um weiteren Protest und einen langwierigen Umbenennungsstreit zu vermeiden, einigten sich Politik und die Familie schließlich auf die nahegelegenen Kühnehöfe. Ende Mai 2013 wurden die Bürgerinnen und Bürger über den Beschluss informiert. Doch auch hier blieb der Protest nicht aus. Vor allem die Traditionsfirma Kühne stellte sich dagegen. Zudem sammelten die Anwohnerinnen und Anwohner Unterschriften gegen die Umbenennung. Nach längerem hin und her entschied man sich für die Umbenennung des nördlichen Teils der Kohlentwiete. Die dort ansässige Firma hatte keinerlei Probleme mit der Veränderung. Doch auch hier gibt es Kritik: Fürsprecher der Straßenumbenennung sind beschämt über den Unmut innerhalb der Bevölkerung. Zudem gehört die Straße zu den wenigen Straßen in Hamburg, die kaum genutzt werden. Ein würdiges Gedenken wird dadurch in Frage gestellt.
Rassistische und verachtende Stereotype werden erschreckend oft genutzt
Vor allem im Rahmen des Protestes der Hamburgerinnen und Hamburger kamen rassistische und verachtende Argumentationsmuster nicht zu kurz: Es herrscht Unverständnis über die Umbenennung einer Straße nach einen sogenannten Fremden. Erstaunlich oft wurde dabei das Argument, alle Ausländer wären kriminell angebracht. Auch die „Auge um Auge, Zahn um Zahn“-Theorie war vor allem bei zahlreichen Leserkommentaren zu lesen. Sprüche wie „Ein ausländisches Todesopfer darf niemals einem deutschen Toten gegenüber bevorzugt werden!“ waren keine Einzelfälle. Auffällig ist auch die klare Trennung der Ausländer von dem Rest der Bevölkerung. Obwohl Menschen mit Einwanderungsgeschichte bereits seit Jahren ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland haben, sind sie hier doch geboren und/ oder aufgewachsen, werden sie nicht als Bewohner der Stadt Hamburg angesehen. Allgemeines Unverständnis, weshalb eine solche Mordserie Anlass für eine Straßenumbenennung sein sollte, taucht innerhalb der Debatte zusätzlich auf. „Ist bis jetzt überhaupt wirklich geklärt, wer für die Morde zuständig war?“ oder „Langsam muss Schluss sein mit dem Gedenkwahn“ sind häufige Statements bei dieser Debatte. Es ist kaum vorstellbar, dass sich hinter diesen Kommentaren die Mitte der Gesellschaft befindet. Und noch weniger zu realisieren ist dabei, dass es sich bei dieser hitzigen Debatte lediglich um eine Straßenumbenennung handelt.
Kassel: kein Verständnis für Umbenennung
Doch ist Hamburg nicht die einzige Stadt, der einer Straßenumbenennung im Gedenken an ein NSU-Opfer mit so viel Skepsis und Unverständnis begegnet wurde. Bereits bei der zentralen Gedenkveranstaltung im Bundestag am 23. Februar 2012 forderte Ismail Yozgat, der Vater des am 6. April 2006 in Kassel vom NSU getöteten Halit Yozgat, neben der vollständigen Aufklärung der Morde die Umbenennung der Holländischen Straße in Yozgat-Straße. Unterstützt wurde er dabei von der damaligen Integrationsbeauftragten der Bundesregierung Maria Böhmer (CDU). Der Bürgermeister der Stadt Kassel war, geprägt durch die emotionalen Worte des Vaters, bereit, sich mit dem Thema einer Umbenennung zu beschäftigen. Von vorn herein schloss er jedoch die Umbenennung der geforderten Straße aus. Dies begründete er mit der Geschichte Kassels. Alternativ entschied er, die an der Straße liegende Straßenbahnhaltestelle umzubenennen und einen sich in der direkten Nähe befindenden Platz nach Yozgats Sohn zu benennen. Diese Entscheidung löste unter den Mitbürgerinnen und Mitbürgern einen großen Aufschrei aus. Absolutes Unverständnis machte sich breit. „Wieso wird dieser Ort nach einem Ausländer benannt?“ „Warum dürfen wir das nicht mitentscheiden?“ „Wer gedenkt in der Türkei an ermordete Deutsche?“ Solche Fragen und viele weitere rassistische Argumentationsmuster wurden im Rahmen dieser Debatte verwendet.
Debatte wird von Politik und Presse zusätzlich angeheizt
Auch vonseiten der Politik wurde gegen die Entscheidung des Oberbürgermeisters gewittert. „Wir werden dieser Umbenennung nicht zustimmen. Für die CDU stellt der Alleingang des Oberbürgermeisters einen übertriebenen Aktionismus dar, der bei der Mehrzahl der Kassler Bevölkerung auf völliges Unverständnis stoße“, erklärte der Fraktionsvorsitzende Dr. Norbert Wett. Doch ihre Strategie, die Kasseler Verkehrs-Gesellschaft zu einer Weigerung der Umsetzung zu stimmen, schlug fehl. Im Falle dieser Umbenennungsdebatte ist auch auf die fehlerhafte Berichterstattung der Lokalzeitungen hinzuweisen. Der vorgesehene Yozgat-Platz vor dem Hauptfriedhof hatte vor der neuen Namensgebung keinerlei Bezeichnung. Es war somit eine Erstbenennung dieses Platzes, wodurch weder ein historischer Hintergrund verändert wurde noch Anwohner durch die dadurch entstehenden Behördengänge betroffen waren.
Rostock: Straßenumbenennung scheitert an den Ortsbeiräten
Dass der Wunsch nach einer Umbenennung auch scheitern kann, zeigt der Fall in Rostock. Am 25. Februar 2004 wurde Mehmet Turgut im Stadtteil Toitenwinkel, Neudierkower Weg durch den NSU ermordet. Mit der Selbstenttarnung des NSU im November 2011 machte sich die Initiative „Mord verjährt nicht!“ zur Aufgabe, Mehmet Turgut ein angemessenes Gedenken zu ermöglichen. Bereits 2012 forderten sie zum ersten Mal die Umbenennung des Neudierkower Wegs in Mehmet-Turgut-Weg, doch scheiterte der Versuch an den Ortsbeiräten.
Nachdem zunächst die Debatte vertagt wurde, entschied man sich letztendlich, diesem Vorhaben nicht zuzustimmen. Aussagen wie „Er war kein Rostocker und ist illegal hier gewesen“ waren für die Entscheidung ausschlaggebend. Zehn Jahre nach Mehmet Turguts Tod, am 25. Februar 2014, veranstaltete die Stadt zum ersten Mal eine offizielle Gedenkveranstaltung. In diesem Zusammenhang wurde ein Denkmal für Mehmet Turgut eingeweiht. Auch seine beiden Brüder gedachten seines Todes. Wenn es nach ihnen geht, sollte die Straße, in der er brutal hingerichtet wurde, seinen Namen tragen, doch ist kaum damit zu rechnen, dass die Ortsbeiräte ihre Meinung ändern.
Ein würdiges Gedenken an Opfer rassistischer Gewalt muss gestattet werden
Es muss möglich sein, auch für die Opfer rassistischer, rechtsextremer Gewalt ein würdiges Gedenken zu gewährleisten. Die drei Beispiele haben gezeigt, dass diese Forderung jedoch nicht selbstverständlich ist. Schnell fühlen sich die Mitbürgerinnen und Mitbürger persönlich angegriffen, fordern ein ordentliches Mitspracherecht in ihrer Stadt und versuchen diese Vorfälle so gut es geht zu verdrängen. Diese Situation gibt es nicht erst seit den NSU-Morden.
Bereits zuvor wurden langwierige, zähe Debatten in anderen Städten geführt, weil auch dort ein Teil der Bevölkerung die Notwendigkeit eines würdigen Gedenkens sah. Sei es die Debatte einer Straßenumbenennung in Berlin für den von Neonazis ermordeten Silvio Meier oder die Kennzeichnung von Stadtraum in Mölln für die verstorbenen Mitglieder der Familie Arslan, die bei einem rassistisch motivierten Brand auf deren Haus drei Angehörige verlor: Innerhalb kürzester Zeit schlägt die Forderung der Hinterbliebenen nach einem würdigen Gedenken in eine unwürdige Diskussion um, in der durch rassistische Stereotype und Diffamierungen ein Feindbild vom „Wir und die Anderen“ konstruiert wird. Dieses immer gleiche Muster offenbarte sich auch bei der Forderung nach einer Straßenumbenennung zum Gedenken an Amadeu Antonio in Eberswalde. Er war das erste Todesopfer rechter Gewalt nach der Wiedervereinigung Deutschlands. 2012 forderte unter anderem die Initiative Light me Amadeu anlässlich seines 50. Geburtstages die Teilumbenennung der Eberswalder Straße in Amadeu-Antonio-Straße. Die Debatte über den Vorschlag war zunächst dermaßen hitzig und von rassistischen Stereotypen geprägt, dass erst mithilfe eines Mediator-Teams aus Hamburg eine würdige Kompromisslösung für ein Gedenken geschaffen werden konnte. So soll noch in diesem Jahr der Amadeu-Antonio-Preis für antirassistische Initiativen verliehen werden. Zudem wird am 9. August das nach Amadeu Antonio benannte Bürgerbildungszentrum eröffnet werden. Doch auch hier ist der Wille, den Ort, an dem Amadeu Antonio ermordet wurde, nicht zu vergessen, noch immer vorhanden.
Inwiefern in Zukunft Städte mit dem Gedenken an Todesopfer rechter Gewalt umgehen werden, bleibt abzuwarten. Die Angehörigen haben jedoch das Recht, dass ihre Wünsche zukünftig stärker in den Blick genommen werden. Denn eine Umbenennung eröffnet der Stadt die Möglichkeit eine symbolstarke Kennzeichnung von Stadtraum, die zeigen würde, dass sie eine Verankerung im Alltag nicht scheuen. Denn das Hauptproblem sind nicht die offensichtlichen Neonazis mit ihren Glatzen und Springerstiefeln, sondern es sind vor allem jene Alltagsrassisten, die mit unreflektierten und stereotypen Aussagen andere Menschen diskriminieren und ausgrenzen.
Lisa Herbst
Dieser Beitrag ist ursprünglich auf dem Portal „Mut gegen rechte Gewalt“ erschienen (2002-2022).