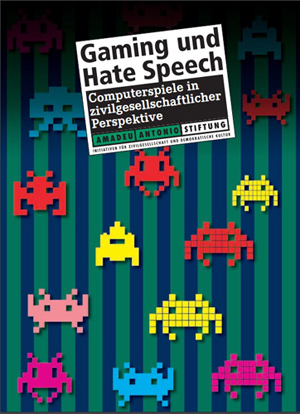Um diese Frage zu beantworten, muss ein Blick auf die Entwicklung von Computerspielen und auf deren gesellschaftliches Umfeld geworfen werden. Rassismus entstand im Europa des 15. Jahrhunderts. Darunter ist die Vorstellung zu verstehen, dass Menschen aufgrund bestimmter Merkmale in unterschiedliche Gruppen eingeteilt und ihnen unveränderliche Eigenschaften zugeschrieben werden können. Beispiele für die alltägliche rassistische Diskriminierung finden sich in allen Bereichen der Gesellschaft – Computerspiele bilden dabei keine Ausnahme. Sie werden von Menschen aus dieser Gesellschaft entwickelt und gespielt. Somit beinhalten sie auch deren Probleme, seien es nun Rassismus, Sexismus oder Antisemitismus. Darin unterscheiden sich Computerspiele nicht von anderen Medien. So wie es rassistische Bücher, Lieder und Filme gibt, so existieren auch rassistische Computerspiele.
Seit Mitte der 1970er Jahre zählen Computerspiele zu den Massenprodukten. Die ersten erfolgreichen Spielekonsolen, etwa von Atari, wurden in dieser Zeit entwickelt. Aufgrund der begrenzten technischen Möglichkeiten gestaltete sich die Charaktererstellung für die Entwickler_innen als schwierig. Es standen nur wenige Bildpunkte (Pixel) zur Verfügung, aus denen Figuren gebaut werden mussten. Dies änderte sich in den darauffolgenden Jahren mit der Steigerung der Leistungsfähigkeit von Computern und Software. Die steigende Komplexität von Computerspielen führte jedoch nicht automatisch zu einer Steigerung der Komplexität der Charaktere abgesehen von der grafischen Darstellung.
Rassistisches Design
Allgemein lassen sich grob zwei Möglichkeiten unterscheiden, Menschen durch das Design von Computerspielen rassistisch zu diskriminieren. Beide haben mit ihrer Darstellung, ihrer Repräsentation zu tun. Die erste Variante rassistischer Diskriminierung besteht darin, nur weiße Charaktere abzubilden. In der zweiten Variante gibt es auch nicht-weiße Charaktere, sie existieren jedoch nur als Ansammlungen von Klischees und Stereotypen.
Bereits im Jahr 2001 stellte eine Studie der Organisation Children Now fest, dass weiße Charaktere in Computerspielen dominieren. Gleichzeitig waren Nicht-Weiße mehrheitlich keine spielbaren Charaktere und auf bestimmte Rollen wie etwa Athlet_innen, Gewalttä- ter_innen und Opfer begrenzt. Acht Jahre später, 2009, führte ein Forscher_innen-Team der University of Southern California eine Art »Volkszählung« in den 150 meistverkauften Games der Jahre 2005/06 durch. Sie fanden heraus, dass der Anteil der Afroamerikaner_innen inzwischen ihrem Bevölkerungsanteil in den USA entsprach. Hispanoamerikaner_innen dagegen wurden weiterhin zu wenig repräsentiert. Allerdings beschränkte sich die Darstellung der meisten Minderheiten-Charaktere noch immer auf Sportspiele und solche, die andere Stereotype wie Gewalttätigkeit bedienten (bit.ly/GamingZensus). Im Bereich der Computerspiele liegen Probleme zunehmend in der Darstellung nicht-weißer Charaktere und ihrer Möglichkeit, als Protagonist_in zu fungieren. Hier zeigen sich Überschneidungen zu anderen Formen von Diskriminierung wie etwa geschlechterspezifischen Zuschreibungen. Diese stereotypen Darstellungen werden inzwischen von Spieler_innen, Journalist_innen und Wissenschaftler_innen kritisiert.
Rassismus als Thema in Games
Inzwischen greifen auch Computerspiele Rassismus als Thema auf. Welche aktuelle Relevanz das Problem des Rassismus in Computerspielen besitzt, soll das Beispiel BioShock Infinite (2013) verdeutlichen. Die Spieler_innen steuern darin einen weißen Privatdetektiv in einem fiktiven 1912. Die Suche nach einem entführten Mädchen führt ihn in die fliegende Stadt Columbia, deren Bewohner_innen in Frieden und Glückseligkeit zu leben scheinen. Hinter dieser Fassade verbirgt sich jedoch das wahre Gesicht dieser Gesellschaft: Dort werden vornehmlich Schwarze rassistisch diskriminiert und ausgebeutet. Die Ausgegrenzten leben in Slums – gezwungen, die Unterhaltungsartikel des weißen Columbias an Fließbändern unter schlechtesten Arbeitsbedingungen herzustellen. Rassistische Plakate hängen in der gesamten Stadt. Gegen diese Unterdrückung führt die schwarze Arbeiterin Daisy Fitzroy ihre Leidensgenoss_innen in eine soziale Revolution, die dazu führt, dass die Unterdrückten ihre Unterdrücker und deren Kinder auslöschen wollen.
Zunächst einmal ist es zu begrüßen, dass ein Computerspiel mit einer großen Zahl an Fans sich des Themas Rassismus annimmt. Bei genauerer Betrachtung muss man jedoch feststellen, dass auch in diesem Spiel rassistische Vorurteile vorhanden sind: Neben dem Umstand, dass ausschließlich ein weißer Mann gespielt werden kann, liegt die Problematik von BioShock Infinite in der Art, wie Daisy Fitzroy dargestellt wird. Die schwarze Frau wird in Kontrast zum weißen Mann gesetzt. Neben dem vernünftigen Privatdetektiv ist Fitzroy eine irrationale Wilde, die, einmal entfesselt, nicht davor zurückschreckt, weiße Kinder zu ermorden. Dieses Bild jedoch ist ein rassistisches Stereotyp. Zumeist knüpft sich daran die Figur des »weißen Erlösers«/der »weißen Erlöserin«: Er/Sie verhilft in Geschichten nicht-weißen Menschen zur Freiheit. Gleichzeitig wird jedoch erzählt, dass die Diskriminierten sich nicht erfolgreich selbst befreien können und folglich von einer weißen Person geführt werden müssen; sie sind ohne den/die »weiße_n Erlöser_in« wie hilflose Kinder.
Auch Computerspiele mit schwarzen Protagonist_innen sind vor rassistischen Darstellungen nicht gefeit, wie das einleitende Beispiel von CJ in Grand Theft Auto: San Andreas (2004) verdeutlichen soll. Gerade Spiele aus der Grand Theft Auto-Reihe haben sich in vielerlei Hinsicht als problematisch erwiesen. Zwar wurden von den Entwickler_innen Widersprüche innerhalb des Charakters CJ angelegt, sie werden jedoch von der restlichen stereotypen Darstellung überschattet. Schwarze Charaktere werden mit Gewalt, Kriminalität und Armut in Verbindung gebracht. Es erscheint so, als wäre dies ihre »natürliche« Lebensweise. Auch die Handlungen, die das Spiel den Spieler_innen überlässt, sind rassistisch eingefärbt. Konflikte werden vornehmlich mit Gewalt gelöst. Die Kleidung, Sprache, Musik und das Setting sind stereotyp. Da hilft es wenig, dass diese Spiele für sich beanspruchen, sehr wirklichkeitsnah an ihren Protagonist_innen zu sein, oder bloß eine satirische Überzeichnung darstellen sollen. Auch die Darstellung rassistischer Polizeigewalt kann diese Vorwürfe nicht gänzlich entkräften. In diesen Spielen werden Klischees und Stereotype ihrer nicht-weißen Protagonist_innen nicht als solche überführt. Im schlimmsten Falle stützen oder bestärken sie diese negativen Vorstellungen der Spieler_innen.
Rassistische Darstellungen bestärken vorhandene Klischees
Davon berichtet eine Studie der Ohio State University aus dem Jahr 2014. Die Wissenschaftler_innen ließen Freiwillige unter anderem im Gangstersimulator Saints Row 2 (2008) mit einer schwarzen oder einer weißen Spielfigur unterschiedliche Aufgaben erledigen. Das Resultat war, dass weiße Spieler_innen, die eine gewalttätige Aufgabe mit einer schwarzen Spielfigur zu bewältigen hatten, auch nach dem Spielen noch dazu neigten, Schwarze allgemein abzuwerten und mit Gewalt zu verbinden (bit.ly/AvatarStudie). Es ist also nicht ausreichend, Spieler_innen nur die Perspektive einer nicht-weißen Spielfigur einnehmen zu lassen, wenn die Darstellung dieser Figur ausschließlich auf rassistischen Stereotypen basiert. Ein Schritt in die richtige Richtung könnte die Änderung der Personalpolitik von Produktionsfirmen sein. Wenn mehr Menschen mit Diskriminierungserfahrungen eingestellt würden, könnte sich ihre Perspektive auch in den Spielen niederschlagen und zur Vermeidung von diskriminierenden Stereotypen führen. Doch auch die anderen Beteiligten in der Entwicklung und dem Vertrieb von Computerspielen sollten ihre Perspektive verändern. Hierzu sollten rassismuskritische Schulungen innerhalb der Unternehmen für die Mitarbeitenden stattfinden, um auch andere dunkelhäutige Charaktere als nur Kriminelle, Spaßvögel oder Athlet_innen entstehen zu lassen.
Dieser Text ist ein Auszug aus der Broschüre „Gaming und Hate Speech – Computerspiele in zivilgesellschaftlicher Perspektive“ der Amadeu Antonio Stiftung.