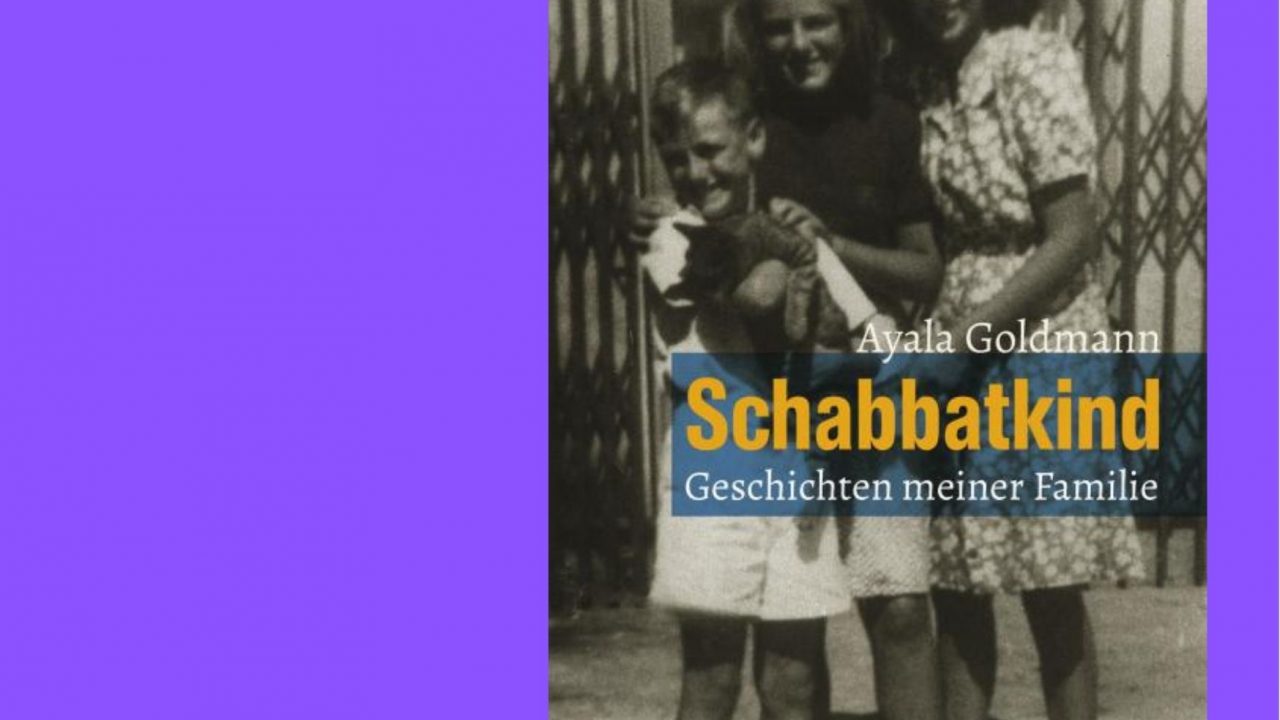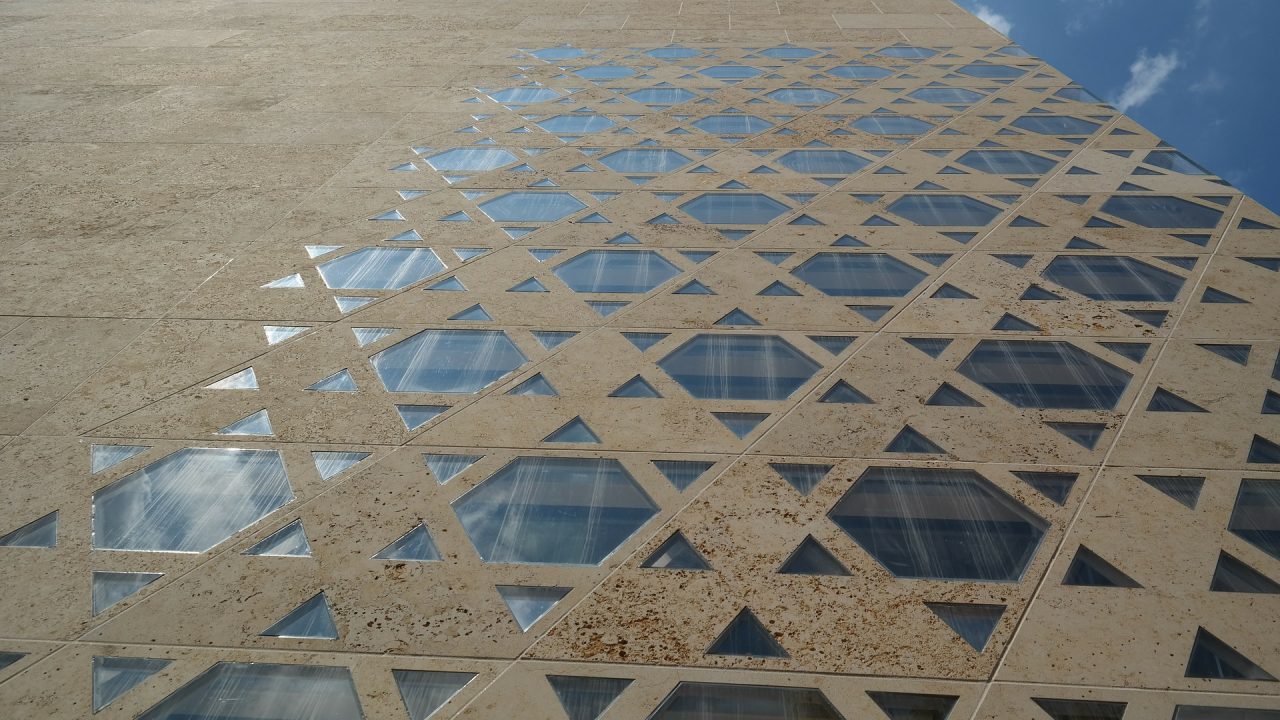Der „Historikerstreit 2.0“ hat 2021 monatelang die Feuilletons gefüllt, die Grenzen des Sagbaren wurden verschoben. Es wurde suggeriert, es gäbe ein „Tabu“, den Holocaust mit anderen Genoziden zu vergleichen, bei der deutschen Erinnerungskultur handele es sich um einen provinziellen „Katechismus der Deutschen“, der der Bevölkerung von „selbsternannten Hohepriestern“ aufoktroyiert wurde und weiter hieß es, das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus und die Shoah seien schuld daran, dass in Deutschland die Aufarbeitung der koloniale Vergangenheit nicht so richtig in die Gänge komme. Der kleine Sammelband „Ein Verbrechen ohne Namen“ versammelt die Texte namhafter Historiker:innen, die diesen Suggestionen kenntnisreich den Boden entziehen.
Das Büchlein hebt an mit einem vierseitigen Text des Philosophen Jürgen Habermas, der mit „Statt eines Vorworts“ überschrieben ist. Er enthält grundsätzliche Überlegungen zur Vergleichbarkeit von Genoziden, der Spezifizität der Shoah und der Kontinuität des christlichen Antisemitismus sowie der Dynamik des politischen Selbstverständnisses von Bürger:innen in einer Einwanderungsgesellschaft. Dabei hat der Text vor allem symbolischen Charakter: Im Historikerstreit von 1986/87 kritisierte Habermas prominent die „apologetischen Tendenzen“ diverser Versuche, die Shoah als „Reaktion“ auf die Verbrechen der Sowjetunion zu deuten und damit ihre Präzedenzlosigkeit in Abrede zu stellen. Indem Habermas kurzer Text den Band eröffnet, wird der gegenwärtigen Debatte über die Bedeutung der Shoah ähnliche Bedeutung zugemessen wie der von 1986/87.
Den darauf folgenden Aufsatz eröffnet Saul Friedländer mit einer „kurze[n] Erinnerung an einige Fakten“ über die Shoah und weist darauf hin, dass das Leiden eines jeden Menschen unvergleichbar sei, die Präzedenzlosigkeit der Shoah jedoch im historischen Kontext liege. Deswegen skizziert Friedländer zunächst die Geschichte der antisemitischen Politik, die im Nationalsozialismus und der Shoah gipfelte. Im Anschluss weist er Missverständnisse im postkolonialen Denken über die Rolle der Zwangsarbeit in der Shoah zurück und kommt zum Schluss: „Obwohl der Holocaust nicht isoliert betrachtet werden wollte, war sein wahrer Kontext nicht der Kolonialismus, sondern die jahrtausendelange Gegnerschaft gegen Juden und Judentum die neben anderen Faktoren die paranoide NS-Ideologie und ihre obsessiven Purifizierungspraktiken prägte.“ Die Beschreibung der Gründung des Staates Israels als „koloniale Landnahme“ weist Friedländer als einseitig zurück und äußert sich besorgt über den durch solche Verleumdungen bedingten Zulauf anti-israelischer Bewegungen und das damit verbundene Phänomen „gewaltsamer Massenausbrüche von Judenhass […] in den Vereinigten Staaten“ etwa im Kontext der Black-Lives-Matter Demonstrationen.
Es folgt ein Aufsatz von Norbert Frei, der sich der Geschichte der Erinnerungspolitik in Deutschland widmet und Dirk Moses Behauptung, bei der deutschen Erinnerungskultur handele es sich um einen von „amerikanischen, britischen und israelischen Eliten“ aufgezwungenen „Katechismus“, ad absurdum führt. Frei erinnert daran, dass eine gesellschaftliche Auseinandersetzung mit den Verbrechen des Nationalsozialismus eben nicht „von oben“ oktroyiert wurde, sondern in mehreren Phasen „von unten“ gegen Widerstand erkämpft wurde. Damit weist er auch darauf hin, dass die Polemiken von Dirk Moses gegen die „Provinzialität“ deutscher Erinnerungspraktiken nicht nur denen gegenüber verächtlich ist, denen gedacht wird, sondern „es ist auch von erstaunlicher Bösartigkeit gegenüber den Intentionen all derer, die sich seit Jahrzehnten in Gedenkstätten und Dokumentationszentren um historisch-kritische Aufklärung bemühen.“ Dass die sich in solchen Kämpfen offenbarenden „gesamtgesellschaftlicher Selbstverständigungsbedürfnisse“ bis heute andauern zeigt, wie unsinnig die These eines erstarrten „Katechismus“ ist. Ergebnis dieser Kämpfe ist dabei Frei zufolge auch, dass bezüglich der Aufarbeitung des Kolonialismus in Deutschland „einiges in Bewegung“ ist. Dass Moses Polemiken gegen die deutsche Erinnerungspolitik Beifall von extrem rechter Seite ernten ist dann nur noch der Beleg dafür, dass es Moses „um Verbesserungen, etwa der zeitgeschichtlichen Bildungsarbeit in einer postmigrantischen Gesellschaft – gar nicht geht. Ziel ist vielmehr die Etablierung neuer Regeln: Der Holocaust soll […] gegenüber anderen Genoziden relativiert werden.“ [47]
Im einzigen exklusiv für diesen Band geschriebenen Aufsatz „Über Holocaustvergleiche und Kontinuitäten kolonialer Gewalt“ erinnert Sibylle Steinbacher zunächst knapp an die Entstehungsgeschichte der vergleichenden Genozidforschung und merkt kritisch an, dass sich „deren Fragestellungen […] aus Sicht der quellengestützt arbeitenden Zeitgeschichtsforschung über den Holocaust […] zunehmend von der Empirie entfernt haben. Hinzu kommt, dass Ereignis- und Erinnerungsgeschichte umstandslos miteinander vermengt werden.“ Nachdem auch Sie die „einzigartigen, besser: präzedenzlosen“ strukturellen Besonderheiten der Shoah benennt und die Shoah so in der Globalgeschichte des 20. Jahrhunderts verortet, konstatiert sie trocken: „Es gibt schlichtweg kein Vergleichstabu.“ Steinbacher benennt den Elefant im Raum, wenn sie deutlich macht, dass hinter den „Schlachtrufen“ und dem „kulturrevolutionären Furor“ letztlich (immer auch) eine Attacke gegen den Staat Israel steckt: „Der Holocaust darf auch deshalb nichts Besonderes sein, weil sich dann – und erst dann – die Legitimität des jüdischen Staates in Frage stellen lässt.“ Dabei findet Steinbacher es nicht nur „erstaunlich, wie selbstverständlich einem antisemitische Topoi untergejubelt werden sollen“, sondern auch, dass das bisher in der öffentlichen Debatte kaum jemanden gestört hat.
Der Aufsatz von Dan Diner handelt von der Rolle „kognitiven Entsetzens“ in der Debatte um Genozide und schildert zunächst die historischen Umständen, unter denen Rafael Lemkin 1944 den juristischen Begriff „Genozid“ prägte. Damit macht er auf die Notwendigkeit und Schwierigkeit aufmerksam, „zwischen verschiedenen Arten kollektiven Tötens und entsprechenden Sterbens zu unterscheiden“. Eine „agnostische Haltung“, die Differenzierungen zwischen Massakern, ethnischen Säuberungen und Genozid scheut, weist Diner deswegen zurück. Darüber hinaus macht er darauf aufmerksam, dass der Begriff des Genozides die Aufmerksamkeit „von der Tat in die Zugehörigkeit“ zu einem Kollektiv verschiebt. Weil der Holocaust eine Tat am Kollektiv der Juden war, ruft er Diner zufolge „vornehmlich in christlich imprägnierten Kulturen mit Juden verbundene traditionell kulturell-religiöse Gedächtnisse auf“. So verortet Diner die Attacken gegen diejenigen, die die Präzedenzlosigkeit des Holocaust behaupten, in Kontinuität mit der christlichen Polemik gegen den vermeintlichen Auserwähltheits-Dünkel der Juden: „Sollte der Holocaust anders, genauer: in seinem Schrecken womöglich ‚mehr‘ gewesen sein als ein Genozid unter Genoziden, so stünde dies dem Ethos einer vorausgesetzten menschlichen Gleichheit entgegen – eine als unerträglich empfundene Anmaßung.“ Die koloniale Gewalt sei eine Gewalt „eigenen Unrechts“, zu deren Aufarbeitung man nicht die Shoah relativieren braucht. Im Anschluss gibt Diner recht gedrungen – und deswegen nur bedingt nachvollziehbar – seine These, bei der Shoah handelte es sich um einen präzedenzlosen „Zivilisationsbruch“. Der Sammelband endet düster mit einer Klage über die Reduktion Winston Churchills auf dessen rassistische Positionen im Rahmen der Black Lives Matter-Proteste in England: „Sollte dies alles werden, was von Churchill bliebe, dann […] dürfte auch Hitler aus dem historischen Gedächtnis getilgt werden.“
Der Sammelband bietet einen soliden Einstieg, um sich kritisch mit den Argumenten und Suggestionen des „Historikerstreits 2.0“ auseinanderzusetzen. Gerade weil er kürzere Texte verschiedener Autor:innen – allesamt Koryphäen auf ihrem Gebiet – versammelt, bietet er ein breites Spektrum an Argumenten, Widerlegungen und Deutungen. Dabei ist es ist es insbesondere wertvoll, dass mehrere Autoren in ihren Texten die immer noch vernachlässigte Kontinuität der christlichen Judenfeindschaft über die Shoah bis hin zur gegenwärtigen Debatte klar benennen und die Angriffe auf den Historikerstreit in Bezug zu gegenwärtigen Diskursen des israelbezogenen Antisemitismus verorten. Um die Relevanz des Büchleins und damit das Büchlein selbst zu verstehen, ist es hilfreich, die Texte von Dirk Moses, Jürgen Zimmerer und Michael Rothberg, die den Anlass zur gegenwärtigen Debatte gaben, zu kennen. Diese Texte sind aber bislang frei online verfügbar. Es wäre zu wünschen, dass künftige Debatten nicht hinter die in diesem Bändchen präsentierten Texte zurückfallen. Da sich der diskutierte Angriff auf die deutsche Erinnerungskultur von Links bisher von Tatsachen und seriöser Forschung wenig stören ließ, ist das aber auch in Zukunft leider kaum zu erwarten. Wer aber vielschichtige Argumente sucht, um in zukünftigen Debatten bestehen zu können, wird in diesem Band fündig.
Ein Verbrechen ohne Namen. Anmerkung zum neuen Streit über den Holocaust, 94 Seiten, 12,00 Euro, C.H. Beck, ISBN 978-3-406-78449-1. Hier bestellen.
Joël Ben-Yehoshua ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei RIAS Thüringen am IDZ Jena und Lehrbeauftragter am Institut für Philosophie der Philipps-Universität Marburg. Er promoviert zum Thema Lügen und Antisemitismus.