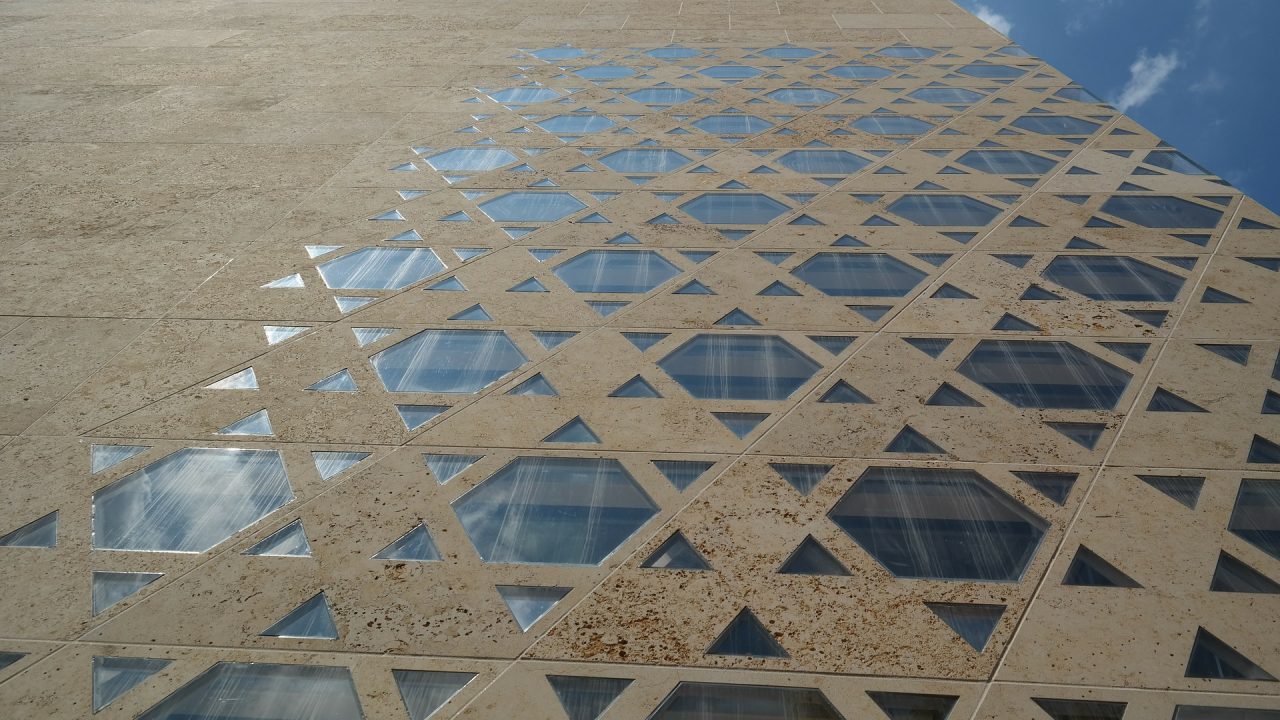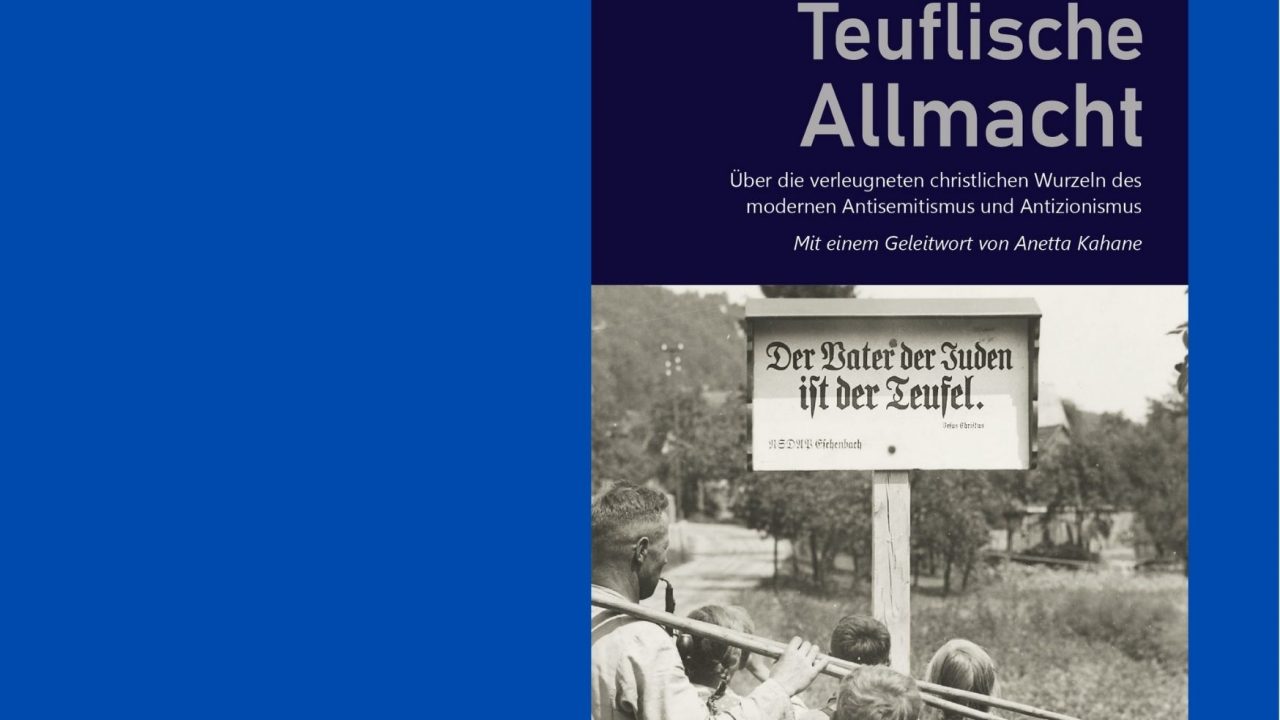„Als Kind hatte ich Angst, meine Mutter könnte sich das Leben nehmen, und so nahm ich mir vor, immer zu lächeln, um sie am Leben zu halten. Ich wollte ihr Freude bereiten.“ Mit diesen Worten eröffnet Stella Leder ihre aufrüttelnde Spurensuche nach ihren familiären jüdischen Wurzeln. Diese sind zugleich eingewoben in die Geschichte der Bundesrepublik und der ehemaligen DDR.
Stella Leder, Enkeltochter des bekannten jüdischen DDR-Schriftstellers und Literaturfunktionärs Stephan Hermlin (eigentlich Rudolf Leder), wurde 1982 in Westdeutschland geboren. Ihre Mutter Bettina war 1977 aus der DDR in die Bundesrepublik übergesiedelt, als Folge ihres Protests gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns. Die Verfolgung und Ausbürgerung Biermanns im Jahr 1976, nach seinem Kölner Konzert, verstand Stephan Hermlins seinerzeit 23-jährige Tochter vor allem vor dem Hintergrund von Biermanns jüdischer Familienbiografie. Dies war für Stellas Mutter unerträglich: „Der antifaschistische Staat DDR handelt mit einer Nazi-Methode gegen das Kind eines ermordeten Juden“ (S. 28) sagte sie, ihre eigene jüdische Familienbiografie erinnernd. Hiermit war ihr Rauswurf aus der DDR – sie hatte zu diesem Zeitpunkt einen zweijährigen Sohn – besiegelt. Nach ihrer Übersiedelung nach Westdeutschland setzte sich ihre Bespitzelung – und die Bespitzelung ihrer beiden Kinder – fort. Erstmals geahnt habe dies ihre Mutter 1990, erfuhr die Autorin später in gemeinsamen Gesprächen.
Fünf Jahre nach Bettina Leders Übersiedelung in die Bundesrepublik wurde die Autorin – Stella Leder – geboren. Sie arbeitet seit vielen Jahren beruflich in der Arbeit gegen Rechtsextremismus. Der beim ersten Lesen irritierend, bewusst sperrig anmutende Buchtitel –Meine Mutter, der Mann im Garten und die Rechten – verweist auf das komplizierte, schmerzhafte seelische und familiäre Erbe, das sie annahm – und nun literarisch in beeindruckender, fesselnder, direkter Weise vor dem Leser entfaltet. Ein Werk, das niemals langweilig zu werden droht und das auch die in den Erzählstrang eingebundenen theoretischen Ausführungen etwa zum Antisemitismus gut erträgt.
Großvater Stephan Hermlin
Da ist einerseits Stella Leders 1915 geborener Opa Stephan Hermlin, der in Chemnitz und Berlin aufgewachsene jüdische Verfolgte und kommunistische Widerständler. 1936 war er nach Palästina gegangen, danach nach Frankreich und in die Schweiz. 1945 ging er als Rundfunkredakteur anfangs nach Frankfurt am Main, zwei Jahre später dann nach Ost-Berlin. Als Kommunist und Autor wollte er die DDR aufbauen, 1949 verfasste er sein berühmtes Gedicht „Die Asche von Birkenau“ – was die Autorin feinfühlig in seiner ganzen Widersprüchlichkeit nachzeichnet. Da ist dessen Ehefrau Gudrun, die 16 Jahre jüngere linientreue Sozialistin, von der sich Stephan Hermlin nach zehn Jahren trennen sollte. Eine Frau die, wie Stella Leder und deren Mutter nach Öffnung der Stasi-Akten erfuhren, ihre eigene Tochter und Enkeltochter systematisch bespitzelte – ein Schock.
Autobiografie, jüdische Familienbiografie und gesellschaftliche Entwicklung: Dies alles bildet ein unaufhebbares Wechselgeflecht, wie die Autorin nachdrücklich, in persönlich erzählender Weise, entfaltet: Da ist einerseits die jüdische Familiengeschichte einer Verfolgungsgeschichte – zu der übrigens auch die 1981 geborene Schriftstellerin Mirna Funk gehört – , und andererseits die „Stasi-Geschichte“. Die Autorin ist sich bewusst, dass diese komplizierte, widerspruchsreiche jüdische Familiengeschichte, angesiedelt in der DDR wie auch der Bundesrepublik, von ihrer nicht-jüdischen Umwelt ganz überwiegend innerlich nicht als Realität akzeptiert werden kann. Oder Stella Leders Worten: „Mir ist bewusst, dass manche sie für übertrieben oder unwahrscheinlich halten werden.“ (S. 17)
In sehr direkter Weise beschreibt die Autorin ihre ambivalente Beziehung zu ihrer Großmutter Gudrun; die verstörende Tiefenschärfe dieser Beziehung wurde ihr erst schrittweise, nach der Lektüre der Stasi-Akten, bewusst: Anfang der 1960er Jahre hatten sich ihre Großeltern getrennt. Ihre Großmutter heiratete daraufhin einen besonders linientreuen Parteikommunisten und angesehenen Schauspieler, der ohne innere Schwierigkeiten „von KPD zu NSDAP zu SED gewechselt“ war (S. 17).
Der 1934 nach Palästina gegangene Bruder Alfred
Und da ist Stephan Hermlins zwei Jahre jüngerer Bruder Alfred. Dieser war 1934, da war er erst 17, aus zionistischer Überzeugung in das ferne, noch unterentwickelte Palästina gegangen, nachdem er in einem zionistischen Hachschara-Lager eine Ausbildung erhalten hatte; diese bereitete ihn auf die Übersiedelung nach Palästina vor. Seine Auswanderung im Jahr 1934 war auch, wie Stella Leder hervorhebt, ein bewusster Akt des Widerstandes, der jüdischen Selbstbehauptung. 1941 ging er weiter nach England, kämpfte als antifaschistischer Flieger der Royal Air Force gegen die Deutschen. 1943 kam er bei einem Flugzeugabsturz ums Leben, da war er erst 26.
Stella Leder ist in ihrer literarischen Darstellung äußerst feinfühlig. Und sehr direkt. Immer wieder erlebte sie schockhaft die Einfühlungsverweigerung ihrer Umwelt, deren Unfähigkeit aber auch Unwilligkeit, jüdische Verfolgungs- und Selbstbehauptungsbiografien zu verstehen. Sie erwähnt den letzten Brief Alfreds an seinen zwei Jahre älteren Bruder Stephan, in dem dieser „seinen eigenen, vergeblichen Tod“ (S. 183) vorhersagte. Dieser Brief mit Foto hing immer im Arbeitszimmer ihres Großvaters.
„Private Befindlichkeiten“ – eine höchst fragwürdige Stolpersteininschrift
Die Entscheidung, das eigene jüdische Schicksal in die Hand zu nehmen, nicht weiter Spielball des Antisemitismus der Mehrzahl der Deutschen zu bleiben, war eine bewusste Entscheidung von Alfred sowie von dessen Eltern David und Lola – Stellas Urgroßeltern. „Unsere Großmutter Lola war sich sehr bewusst darüber, was der Machtantritt der Nationalsozialisten für die Juden in Deutschland bedeutete. Deshalb hat sie frühzeitig dafür gesorgt, dass ihre Kinder nach Palästina auswanderten – bevor die Flucht unausweichlich wurde“ (S. 183). Dies schrieb Stellas Mutter an den Kölner „Aktionskünstler“ Gunter Demnig, Initiator der Stolpersteine.
Im Anschluss hieran beschreibt die Autorin eine zutiefst verstörende Szene, die ihre Mutter und deren 16 Jahre ältere Halbschwester Andrée mit Demnig hatte. Demnig, dessen Stolpersteine sowohl Begeisterung als auch tiefe Abneigung bis hin zum offenen Hass bei einigen jüdischen Verfolgten hervorrufen – ein Thema, über das man Vieles schreiben könnte, vor allem aus psychoanalytischer Perspektive – , wollte auf Alfreds Stolperstein als Motiv „Flucht“ schreiben. Hermlins Verwandten baten ihn brieflich nachdrücklich, schon verzweifelnd begründend, stattdessen den Begriff „Auswanderung“ zu verwenden – deshalb vorhergehende kurzer Auszug aus diesem Brief. Als enge Verwandte des jüdischen Opfers und als verfolgte jüdische Familie sollten sie doch jedes Recht hierfür haben, sollte man denken. Es erscheint als unvorstellbar, dass ein nicht-jüdischer Deutscher wie Demnig ihnen dies verweigern könnte. „Vorher gegangen zu sein: Darin liegt doch ein Stück Stolz“ (S. 183), schrieben sie dem umtriebigen Stolpersteinverleger erklärend. Dieser reagierte in einer schon brutalen deutschen Kälte: Er würde nicht wegen „privater Befindlichkeiten“ von seiner Entscheidung abweichen, ansonsten komme es zu einem „Durcheinander“ antwortete dieser wörtlich. Ihr Großonkel sei nicht freiwillig gegangen, konstatierte Demnig. Der Wunsch von Juden, nicht in Deutschland zu leben sondern in einem eigenen jüdischen Staat unter Juden zu leben, frei von jeglichem Antisemitismus und deutscher Besserwisserei, davon möchte der Betreiber der Stolpersteine offenkundig nichts wissen, dies akzeptiert er nicht.
Stella Leder nimmt diese gefühllose Kälte vieler Deutscher, denen sie in ihrem Leben immer wieder begegnete – was sie im Buch detailreich nacherzählt- , dennoch zum Anlass, um den komplexen Prozess der jüdischen Selbstbehauptung, des jüdischen Widerstandes ab Anfang der 1930er Jahre nachzuzeichnen.
Ihre Mutter Bettina und deren Halbschwester verzichteten auf eine weitere Antwort an Demnig. Sie waren zu entmutigt, wollten die Stolpersteinverlegung nicht durch eine weitere Erklärung gefährden. Die jüdischen Verwandten und Nachkommen des Toten musste schweigen, sie hatten kein Mitspracherecht bei der Gestaltung des Stolpersteines: „Gunter Demnig aber hat den Stein nach seinem Plan gestaltet. „Flucht““, notiert Stella Leder lakonisch (S. 184).
Eike Geisel, hieran sei erinnert, sprach in diesem Kontext von der „Wiedergutwerdung der Deutschen“ – Geisels klarsichtigen, bitterscharfen und grundehrlichen Analysen und Polemiken erschienen erst posthum 2015, 18 Jahre nach seinem Tod, in Buchform. Die Erinnerung der Deutschen war für Geisel die „höchste Form des Vergessens“; dennoch insistierte Geisel ironisch: „Some of my best friends are German“.
Geisel, der aus „der Linken kam und einer der scharfsinnigsten Kolumnisten und Kritiker des „linken Antisemitismus“ war, publizierte in den 1970er und 1980er Jahren in bekannten linken und liberalen Medien. Geisel richtete sich mit dieser ironischen Sentenz also insbesondere gegen jene Linken, die, wie Alex Feuerherdt in einem haGalil-Interview zu dem Film „Triumph des guten Willens“(Mikko Linnemann 2016) ausführte, mit „unheilbar gutem Gewissen stets beteuerten, sie könnten gar keine Antisemiten sei“, weil ja einige ihrer besten Freunde Juden seien (Kaufhold 2016). Diese Analyse der bewussten und unbewussten Motive bei der Beschäftigung mit und Verleugnung der radikal antisemitischen Motive der Shoah lässt sich auch auf die konträre Stolperstein-Diskussion übertragen: Auf Demnigs Stolpersteinen findet sich höchst selten – wenn überhaupt – die nüchterne Feststellung, dass das Opfer als Jude verfolgt und ermordet wurde.
Nicht von der Sprache, wohl aber von der erlebten Geschichte her treffen diese Interpretationen mit Stella Leders klarsichtigen autobiografischen Beschreibungen überein. Solche Erfahrungen machte sie bereits als Schülerin in westdeutschen Städten.
Die verstörenden Stasi-Akten ihrer Großmutter Gudrun
Als sie gemeinsam mit ihrer Mutter erstmals die Stasi-Akten las entwickelte Stella Leder das verstörende Gefühl, „mein ganzes Leben betrogen und belogen worden zu sein.“ (S. 19) 1988, am Tage ihrer Einschulung in Bremen, war Stella in ihrem Garten einem fotografierenden Stasi-Mann – der sie in seiner olivgrünen Kleidung an einen Nazi erinnerte – erstmals begegnet. „Immer wenn ich mich umdrehte, verschwand der Mann hinter den Bäumen, sodass ich ihn nicht sehen konnte“ (S. 7) notiert sie im Vorspann ihres außergewöhnlichen Werkes. Das unwirklich anmutende frühe Bild wurde sie nie wieder los, es nistete sich in ihre Gedanken, Fantasien und Träumen ein. Nie wusste sie sicher, ob diese Szenen aus ihrem sechsten Lebensjahr nun Realität oder Fantasie gewesen war. Es ist „der Mann im Garten“, dem wir schon auf dem Buchtitel begegnen. „Als wir wegzogen, folgte der Mann mir in meine Träume“, schreibt Stella Leder im Vorspann. „Dass er von der SA war, lernte ich in der fünften Klasse durch einen Blick in mein Geschichtsbuch.“ (S. 7)
Gefühle des Verlustes, der abgrundtiefen Trauer, die Stellas Mutter in sich trug, vermochte ihre eigene, parteilinientreue Mutter Gudrun nicht zu ertragen. Sie erlebte diese als innere und äußere Gefahr – und begann ihre eigene, 13-jährige Tochter ab dem Jahr 1967 umfassend zu observieren und hierüber Stasiberichte zu verfassen.
Nach einem letzten Gespräch Ende der 1990er Jahre brach die Autorin ihren Kontakt mit ihrer Großmutter Gudrun ab, nachdem diese erneut mantrahaft betont hatte, „von allem nichts gewusst“ zu haben. Als diese 2019 verstarb hatte sie ihre Tochter und Enkelin enterbt.
Eine Jugend in Westdeutschland
Weitere Buchkapitel handeln von Stella Leders wechselhafter Kindheit und Jugend in Berlin, Bremen, der hessischen Provinz und in Frankfurt. Immer wieder wurde sie von ganz konkreten Nazis bedroht, erlebte hierbei weder von ihren Lehrern noch von ihrer Umwelt Unterstützung. Nazis gab es nicht in Westdeutschland, das sei eine absolute Minorität ohne gesellschaftliche, konkrete Relevanz, wurde ihr immer wieder versichert. Ihre eigenen Verfolgungserlebnisse, die die Autorin im Buch eindrücklich beschreibt, standen im Kontrast zu diesen Verlautbarungen. In der hessischen Provinz wurde sie als Jüdin vielfach und massiv von den örtlichen Neonazis bedroht und verfolgt – und entkam nur mit äußerstem Glück. Sie und ihre Freunde schwiegen hierüber, weil sie wussten, dass sie kein Gehör finden würden.
Jedes Thematisieren der sehr konkreten Bedrohungserlebnisse hätte gesellschaftliche Ausschließungsprozesse zur Folge gehabt. Das gehörte sich nicht, Neonazis als eine gesellschaftliche Realität zu benennen. „Dieses Schweigen gehörte zu den Benimmregeln der Dorfgemeinschaft.“ (S. 50) „Judenwitze“ gehörten in Bremen, in der hessischen Provinz wie auch in Frankfurt zu Stellas schulischem Alltag. Als sie dies als Jugendliche in Berlin zu thematisieren versuchte – nach einem Auschwitzbesuch in der zwölften Klasse, an der Stella wegen ihres jüdischen Familienhintergrundes nicht teilnehmen wollte –, wurde sie von ihrer Geschichtslehrerin weltanschaulich scharf zurecht gewiesen: „Jüd:innen verursachten das Leid der Palästinenser:innen, obwohl gerade sie es doch besser wissen müssten“, stauchte die „kritische“ Lehrerin die jüdische Schülerin, die sich der wiedergutmachenden Auschwitz-Fahrt verweigert hatte, zusammen. Und „Nelson Mandela habe Israel immerhin einen Apartheitsstaat genannt“ (S. 166).
15 Jahre später sollte Stella Leder vergleichbarer deutscher, linker Wut immer wieder in ihren Seminaren zum Antisemitismus und Rechtsradikalismus begegnen – das allgegenwärtige, schwer zu ertragende linke und liberale selbstgerechte deutsche Elend, das gleichermaßen Grass und Walser, Ströbele, Kunzelmann und Horst Mahler repräsentieren (Kaufhold 2018). Was diese Israelis mit den Palästinensern machten, das sei doch genauso schlimm wie…, schallte es ihr sogar von Historikern entgegen.
Die 16-jährige Schülerin verstummte voller Panik und Hilflosigkeit, die Angst raubte ihr die Denkfähigkeit. Heute, ein Viertel Jahrhundert später, erinnert sie sich nur noch eines Bildes von sich und ihrer Lehrerin, „inmitten der Auschwitz-Plakate“ (S. 167).
Gemeinsame Albträume
Als die Autorin 15 Jahre später in der Präventionsarbeit gegen Rechtsextremismus arbeitete wiederholte sich dieser sekundäre Antisemitismus immer wieder. Nichts hat sich geändert in den vergangenen Jahrzehnten. Als die Neonazis dann regelmäßig vor ihrem Beratungsbüro standen lernte die Autorin rasch, dass die Polizei für sie und ihre Kollegen häufig kein Helfer war – im Gegenteil: Auszüge aus ihren Mitteilungen an die Polizei fand sie wenig später in Neonazimitteilungen wieder. Einer der leitenden „Nordkreuz-Angehörigen“– ein neonazistisches Netzwerk – „war in der Polizeiinspektion tätig, mit der ich zusammengearbeitet hatte.“ (S 101)
Überschrieben hat die Autorin diese Kapitel mit „In der Gedächtnislücke. Erinnerungsabwehr im Schulunterricht“ sowie „Israel im Klassenzimmer“. Während ihrer eigenen Schulzeit hatte sie niemals von den Verfolgungserlebnissen ihrer Urgroßmutter Lola erzählt, von deren beschämenden Erfahrungen mit den „Wiedergutmachungs“prozessen (vgl. Kaufhold 2020, 2021a). Die Scham siegte, nachts hatte die Autorin fürchterliche Albträume. Als sie diese später ihrer Mutter erzählte sagte ihr diese, dass sie die Verfolgungsträume ihrer Mutter geträumt habe. „Transgenerationelle Traumaweitergabe“, wie sie etwa kürzlich die Traumatherapeutin Maya Lasker-Wallfisch in autobiografischer Weise beschrieben hat (Kaufhold 2021b) sind eine Realität. In der psychoanalytischen und psychiatrischen deutschen Fachzunft werden diese weiterhin mehrheitlich in Abrede gestellt.
Ins „kollektive Gedächtnis“ (S. 27) seien diese neonazistischen Übergriffe nahezu nie eingeflossen. Stella Lederer erinnert an dieser Stelle an Ralph Giordanos seinerzeitigen – 1992/1993 – heftigen öffentlichen Interventionen nach den Überfällen in Rostock, Mölln und Solingen: „Die deutschen Konservativen“, so der streitbare Giordano 1992 in einem Spiegel-Interview, seien „unfähig, sich von rechts wirklich bedroht zu fühlen.“ (S. 41) Für sie stehe der Feind immer links. Es folgte Giordanos geharnischter Brief an Kanzler Helmut Kohl, in dem er zugleich die Notwendigkeit einer jüdischen Selbstbewaffnung öffentlich erwog (Giordano 1993). Es folgten reflexhafte scharfe Zurechtweisungen durch führende CDU-Politiker: Die Angriffe auf den Bundeskanzler seien „unerträglich (…) und auch durch Schmerz und Trauer nicht zu entschuldigen.“ (S. 45) Ein Jahrzehnt später, nach Giordanos scharfer Kritik an der Ditib, wiederholten sich diese Szenen, diesmal von „links“. Der international renommierte Schriftsteller und Journalist Ralph Giordano (Kaufhold 2013, 2014) blieb im „liberalen“ Köln, wo er Jahrzehnte lebte, letztlich ein Ausgestoßener. Bis heute gibt es in Köln keine Ralph Giordano Straße – eigentlich ein Skandal. In seiner Geburtsstadt Hamburg hingegen, in der dieser die Shoah in einem Keller mit äußerstem Glück überlebte – dokumentiert in seiner Familienbiografie Die Bertinis (Giordano 1985) – wurde Giordano immer wieder feierlich vom Senat empfangen. Und hier, in Hamburg-Barmbek, wurde 2017 eine Ralph-Giordano-Piazetta eingeweiht.
Initiativen gegen Rechtsradikale, denen Stelle Leder selbst angehört, lebten immer gefährlich. Gerade in ländlichen Regionen seien sie eine bewusste Entscheidung gegen die Mehrheitsgesellschaft. Auch ihre Mutter hatte als junge Jüdin in der DDR immer gewusst, erfahren, dass es auch in der „antifaschistischen“ DDR Nazis gab. Eine wirkliche „Aufarbeitung“ des Nationalsozialismus habe es weder in der DDR noch in der Bundesrepublik gegeben.
Stella Leder hat ein wirklich tiefgründiges, aufrührendes, grundehrliches, zutiefst persönliches Werk verfasst, das viele Leser verdient. Es gibt nur wenige Werke, denen eine vergleichbare Bedeutung zukommt.
Stella Leder: Meine Mutter, der Mann im Garten und die Rechten. Eine deutsch-jüdische Familiengeschichte, Berlin: Ullstein 2021, 206 S., 22,00 Euro, Bestellen.