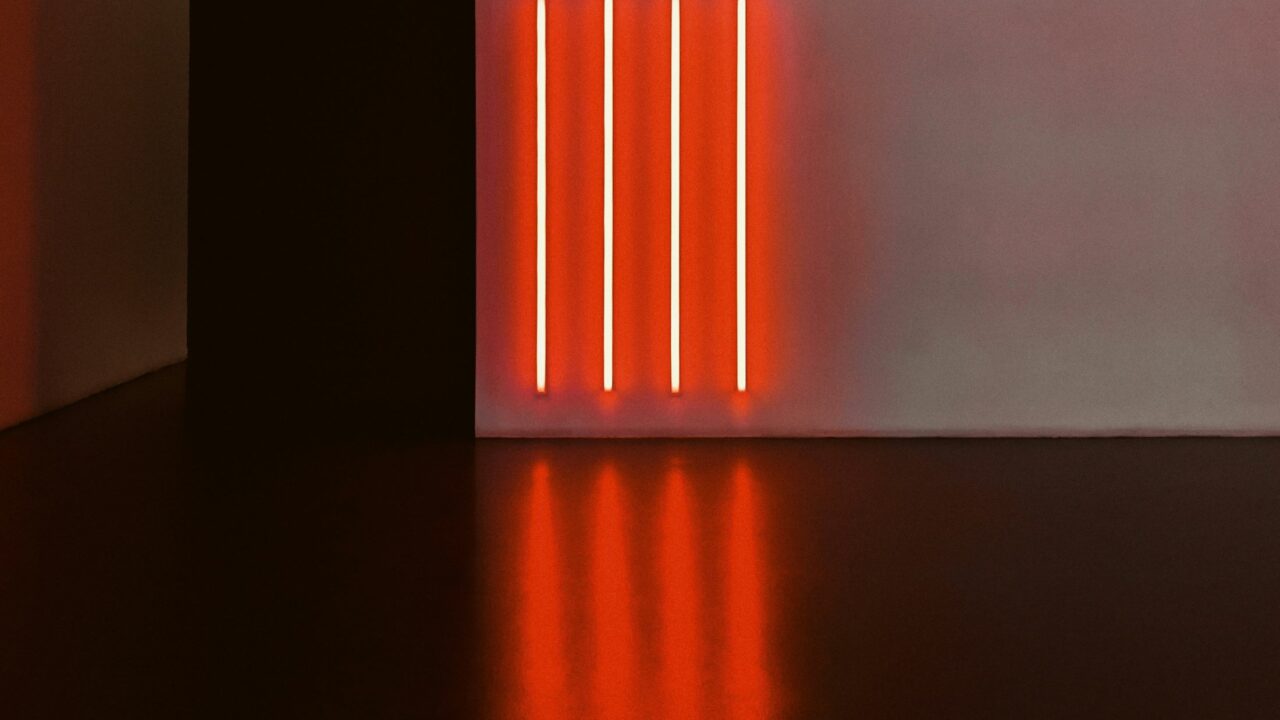
Fabian Bechtle und Leon Kahane arbeiten im Forum demokratische Kultur und zeitgenössische Kunst, einem Projekt der Amadeu Antonio Stiftung, das auf Antisemitismus und antimoderne Weltbilder in Kunst und Kultur blickt. Sie sprechen mit dem Soziologen Natan Sznaider über den israelischen Blick auf Antisemitismus in Deutschland, jüdische Sichtbarkeit und darüber, wem die israelfeindlichen Demos wirklich nützen.
Forum DCCA: Natan, Sie sind in Deutschland geboren und leben inzwischen in Israel. Empfinden Sie einen Unterschied zwischen den Orten, vor allem mit Blick auf den Diskurs um Antisemitismus?
Natan Sznaider: In dem Moment, in dem man aus dem Flugzeug steigt, steigt man auch von einem Diskurs in den anderen. Hier in Israel ist der Diskurs nicht von dem bestimmt, was in Deutschland, in Europa oder in Amerika passiert, sondern von dem, was hier passiert. Es geht hier um diesen unmöglichen Krieg, um die Geiseln und um die Regierung, die wir haben. Das ist eine ganz andere diskursive Lage als die um Antisemitismus in Deutschland oder die um die Befindlichkeit von Juden in Deutschland.
Der Blick von außen auf Israel spielt keine Rolle?
In meinen Kreisen hat man auch das Gefühl, dass diejenigen, die hier in Israel an der Regierung sind, es unheimlich gut finden, dass es in Europa, in Amerika oder in der Welt einen ansteigenden Antisemitismus gibt. Das passt sozusagen in ihr Konzept. Die Erfahrungen von Juden und Jüdinnen in Deutschland möchte ich überhaupt nicht abwerten – ganz im Gegenteil. Wie gesagt, vom hiesigen Standpunkt aus betrachtet, ist es eine ganz andere Geschichte. Ich meine, ein gutes Beispiel dafür war, wie unheimlich aufgeregt die Documenta-Debatte geführt worden ist. Ich war ja selbst ein bisschen daran beteiligt. Zur documenta fifteen gab es in der ganzen Zeit einen einzigen Artikel in der Haaretz. In der hiesigen Kunstszene war das am Rande ein Thema. Die meisten Leute haben das nicht mitbekommen. Es war in der Zeit der Wahlen, die Zeit der neuen Regierung mit ihrem Versuch, das Regime hier autoritärer zu machen.
Hat sich diese Wahrnehmung nach dem 7. Oktober geändert?
Dass der Blick von hier ein ganz anderer ist, gilt auch ganz klar für die Zeit nach dem 7. Oktober. Für uns ist das in erster Linie ein Versagen der militärischen Institutionen, ein Versagen der Souveränität und ein Versagen der Regierung – abgesehen von denen, die noch zu ihnen halten. Die Frage, ob jetzt irgendwelche Studierende in Berlin palästinensische Flaggen schwenken, rückt da einfach in den Hintergrund. Wir befinden uns hier in einer ganz anderen existenziellen Lage.
Was in Deutschland, in Amerika oder Großbritannien auf den Straßen und in den Universitäten passiert, verstärkt hier so ein bisschen das eigene Gefühl, dass, wenn man schon untergeht auf der Titanic, es außerhalb der Titanic auch nicht besser ist. Und wenn man dann den Leuten sagt, ich kann in Berlin U-Bahn fahren, ohne von irgendwelchen Antisemiten verprügelt zu werden, dann gucken die Leute einen ganz erstaunt an. Aber das heißt nicht, dass es nicht Orte und Momente gibt, wo das so ist.
Sie kennen jedoch beide Kontexte und nehmen diese auch wahr. Lässt sich das irgendwie zusammendenken?
Wenn ich auf den Samstagsdemonstrationen hier in Tel Aviv auf der Kaplan bin, dann würde ich gerne einem bestimmten linken Umfeld in Europa und in Amerika zurufen: Das einzige, was ihr mit euren Demonstrationen macht, ist, dass ihr die Rechtsextremen in Israel verstärkt. Aber ihr seid überhaupt nicht hilfreich, wenn es dazu kommt, sich irgendwie für die Geiselbefreiung und für das Ende des Krieges einzusetzen – ganz im Gegenteil. Ich fühle mich hier in Israel in die Zange genommen, von den Rechtsextremen hier und von den Linksextremen in Europa, die zusammen den Status quo festigen.
Wie man sich dazu als Jude in Deutschland verhalten soll, ist natürlich wahnsinnig problematisch. Man kann sich ja nicht mit denjenigen solidarisieren, die beispielsweise in der FU gegen den Krieg in Gaza demonstrieren, aber ebenso wenig mit den Anti-Antisemiten à la Frau Le Pen. Die meisten jüdischen Menschen in Deutschland, würde ich sagen, haben mit den rechtsextremen Messianisten, die wir hier in der Regierung haben, nicht viel am Hut. Die meisten Juden, denke ich, orientieren sich ganz klar an der Idee eines sicheren und demokratischen Israels, haben Sensibilitäten gegenüber den Geiseln im Gaza-Streifen und unterstützen einen Deal zu ihrer Befreiung – auch wenn das eine Aussetzung des Krieges bedeuten würde. Man möchte nicht Teil eines Gemeinwesens sein, was das Überleben der Nation über das Überleben von Einzelnen innerhalb dieser Nation stellt, wie es bei gewissen politischen Milieus in Israel der Fall ist. Und deswegen ist es wahnsinnig kompliziert. Wie äußert man sich öffentlich? Und wie kann man sich positionieren, wie eine differenzierte Meinung äußern, ohne sich gleichzeitig mit denen zu solidarisieren, die einem eigentlich nichts Gutes wollen – auf beiden Seiten. Das ist wahnsinnig kompliziert.
Wie soll man Ihrer Meinung nach mit diesem Dilemma umgehen?
Ich glaube, dass Juden in Deutschland oder in Europa und in Amerika eine ganz klare jüdische Position entwickeln müssen, die autonom ist. Die autonom ist vom politischen Diskurs um sie herum und die autonom ist von den pro-palästinensischen Demonstrationen, die autonom ist von Kreisen wie Judith Butler, aber auch autonom von rechten Nationalisten. Aber wie gesagt, in dem Moment, wo man hier aus dem Flugzeug steigt, dann verschiebt sich das alles irgendwie. Ich steige als Jude in Berlin ins Flugzeug ein und lande hier als Israeli. Und deswegen habe ich dann ganz andere politische und soziale Anliegen und Bedürfnisse.
In Deutschland bin ich dann Jude und würde den anderen Juden zurufen wollen, dass die Position, die man haben soll, eine jüdische Position sein muss. Ich meine, damals bei der documenta gab es diesen Topos des Vertrauensbruchs, den man oft gehört hat. Und ich habe mich gefragt, was für ein Vertrauensbruch? Gab es denn jemals Vertrauen? Was nicht da ist, kann auch nicht gebrochen werden. Wenn man von Vertrauensbruch redet, verlässt man sich auf den guten Willen der Nicht-Juden, wenn es darum geht, die eigenen jüdische Interessen zu vertreten. Das ist spätestens nach dem 7. Oktober vorbei.
Und dennoch nimmt der Antisemitismus zu.
Man muss im gewissen Sinn akzeptieren, dass ein Teil der kulturellen Elite Ressentiments gegen Juden hat. Das kann und soll man öffentlich thematisieren.
Man hätte bei der documenta sagen können: Lasst das hängen, guckt es euch an, das hat ganz klare antisemitische Züge, das hat eine Geschichte, das kommt aus dem sowjetischen Agitprop und so weiter und wenn die Künstler und Künstlerinnen daneben stehen wollen und sich erklären, wäre es gut. Hätten sie es nicht gewollt, auch gut. Aber man macht sie doch nicht zu Märtyrern, die zu Guerilla-Kämpfern für die Kunstfreiheit werden.
Es heißt immer für Antisemitismus im öffentlichen Raum in Deutschland gäbe es keinen Platz. Aber für Antisemitismus im öffentlichen Raum in Deutschland gab es immer Platz und ungeheuer viel Platz. Dazu sollte man stehen, auch und gerade als Jude. Wir erwarten nicht von den Gojim, dass sie den Antisemitismus für uns abschaffen, weil wir davon überzeugt sind, dass er nicht abzuschaffen ist. Sondern wir konfrontieren ihn einfach. Es geht um die Sichtbarkeit. Diese Sichtbarkeit ist, glaube ich, eine wichtige Sache. Weil in dem Moment, wo man glaubt, dass man Antisemitismus aus dem öffentlichen Raum entfernen kann, kann auch im gewissen Sinne das Gegenteil passieren. Das Jüdische wird von dem Sichtbaren zum Unsichtbaren gemacht. Damit kommt dann ein Topos ins Spiel, der dann versucht zu behaupten, dass Juden genauso sind wie alle anderen Menschen auch. Was ja nicht stimmt. Weil wenn Juden wie alle anderen Menschen wären, wären sie ja keine Juden. Das ist eine Falle der Aufklärung, würde ich sagen.
Haben sie dafür ein Beispiel?
In dieser Falle der Aufklärung, der Gleichheit, verlangt man von Juden die Unsichtbarkeit. Sie sollen sein wie alle anderen Menschen auch. Das ist sehr deutlich, wenn es um unser Aussehen geht. Wir sollen keine Käppchen tragen. Wir sollen die Schläfenlocken und den Bart rasieren. Wir sollen so reden wie die Gojim, aussehen wie die Gojim, uns bewegen wie die Gojim. Das heißt, unsichtbar werden als Juden, mit der Hoffnung, dass damit auch der Antisemitismus unsichtbar wird. Aber das ist ja nicht geschehen. Der Antisemitismus ist nicht unsichtbar geworden, aber die Juden. Und deswegen, glaube ich, muss man als ein Gegengift wieder als Jude sichtbar werden. Wie Arendt sagte, wenn man als Jude angegriffen wird, muss man sich als Jude wehren. Darum geht es. Wir müssen da was tun und mit dem Finger draufhauen und sagen: Schaut euch das alle an! Ihr könnt damit einverstanden sein oder nicht. Man kann ja Antisemitismus als Einstellung nicht einfach verbieten. Da helfen auch keine Resolutionen. Dass man anders ist, aber gleich ist, dass man sichtbar ist und unsichtbar ist, ist bedrohend. Und damit muss man leben, glaube ich. Man kann als Jude nicht in irgendeiner illusorischen Welt leben, in der es keinen Antisemitismus mehr gibt.