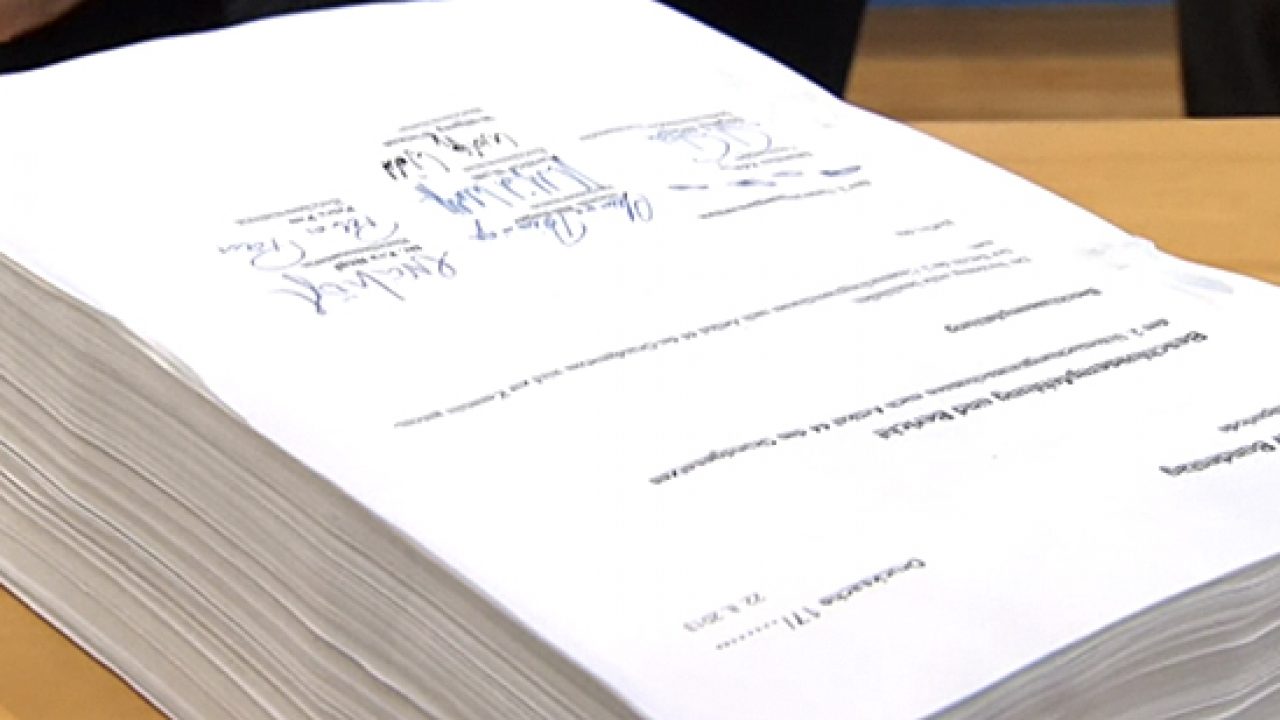
Netz-gegen-Nazis.de: Frau Högl, immer wieder wurde betont, mit welcher Einhelligkeit der NSU-Untersuchungsausschuss nicht nur eingesetzt wurde, sondern auch gearbeitet hat – über alle Fraktionsgrenzen hinweg. Das Ergebnis dieser Arbeit ist nun der Abschlussbericht, der gut 1.300 Seiten umfasst. Wie schätzen Sie die Impulswirkung ein, die von diesem Bericht ausgehen wird?
 Dr. Eva Högl: Ich hoffe, dass die Wirkung des Abschlussberichts groß sein wird. Die größte Gefahr ist jetzt natürlich, dass er einfach in der Schublade verschwindet und sich alle Verantwortlichen hinter der Aussage verstecken, beim NSU habe es sich um einen Einzelfall gehandelt. Ich sage ganz ehrlich, dass ich mir da Sorgen mache. Für mich ist ein zentrales Ergebnis der Arbeit im Untersuchungsausschuss, dass wir es mit institutioneller Diskriminierung zu tun haben. Wenn ich allerdings genau davon spreche, bemerke ich an vielen Stellen reflexartigen Widerstand. Umso wichtiger war die gemeinsame Vorstellung des Abschlussberichts durch alle Fraktionen, von der hoffentlich ein starkes Signal ausgeht. Klar ist aber auch: Wir brauchen Unterstützung.
Dr. Eva Högl: Ich hoffe, dass die Wirkung des Abschlussberichts groß sein wird. Die größte Gefahr ist jetzt natürlich, dass er einfach in der Schublade verschwindet und sich alle Verantwortlichen hinter der Aussage verstecken, beim NSU habe es sich um einen Einzelfall gehandelt. Ich sage ganz ehrlich, dass ich mir da Sorgen mache. Für mich ist ein zentrales Ergebnis der Arbeit im Untersuchungsausschuss, dass wir es mit institutioneller Diskriminierung zu tun haben. Wenn ich allerdings genau davon spreche, bemerke ich an vielen Stellen reflexartigen Widerstand. Umso wichtiger war die gemeinsame Vorstellung des Abschlussberichts durch alle Fraktionen, von der hoffentlich ein starkes Signal ausgeht. Klar ist aber auch: Wir brauchen Unterstützung.
Von wem soll diese Unterstützung kommen?
Zum Beispiel von der Zivilgesellschaft. Stiftungen und Initiativen sollten das, was sie für ihre Arbeit brauchen, einfordern. Wir brauchen allerdings auch andere politische Mehrheiten in Deutschland: Derzeit sorgt etwa die Extremismusklausel dafür, dass engagierte Arbeit gegen Rechtsextremismus unter Generalverdacht gestellt wird. Dazu kommt, dass zivilgesellschaftliche Einrichtungen gegen Rechtsextremismus eine sichere Förderung brauchen.
Vor der Vorstellung des Abschlussberichts haben Nebenklagevertreter bei einer Pressekonferenz beklagt, dass im Bericht nicht von institutionellem Rassismus die Rede ist. Können Sie ihre Enttäuschung darüber verstehen?
Das kann ich sehr gut verstehen. Allerdings habe ich mir sehr lange und intensiv Gedanken darüber gemacht, wie wir das nennen, was wir durch unsere Arbeit im Untersuchungsausschuss gefunden haben. Ich benutze in diesem Zusammenhang eine Formulierung, die bewusst über institutionellen Rassismus hinausgeht, nämlich den Begriff der institutionellen Diskriminierung. Damit meine ich routinemäßige Verdachts- und Vorurteilsstrukturen, die ich sehr deutlich benenne. Ich wollte eben nicht reflexartigen Widerstand erzeugen, doch die Problemlage ist mir sehr klar. Im Einzelvotum der SPD-Fraktion zum Abschlussbericht haben wir das auch genau herausgearbeitet.
Liegt es nicht auch daran, dass das Wort Rassismus in Deutschland immer noch tabuisiert ist?
Tatsächlich provoziert der Begriff immer noch schnell eine Blockade. Und dennoch gibt es Rassismus, etwa in Behörden. Um diesen zu bekämpfen, müssen wir am Verhalten ansetzen.
Das ist nun ausgerechnet die Änderung, die am schwersten ist …
Aber wenn wir uns kennen und uns als Menschen sehen, können wir das Verhalten beeinflussen. Das zeigt das Beispiel des ersten NSU-Mordopfers Enver Simsek, ein türkischer Blumenhändler aus Nürnberg. Wie bei allen anderen Tatorten gingen die Ermittler auch hier davon aus, dass Verwicklungen in die Organisierte Kriminalität zum Verbrechen führten. Sofort stand ein Drogenverdacht im Raum. Nur der bayerische Innenminister Günther Beckstein, der bei Simsek ab und an Blumen kaufte, dachte auch an Rassismus als Tatmotiv – weil er Enver Simsek eben persönlich kannte.
Eine weitere eklatante Fehleinschätzung der Ermittlungs- und Sicherheitsbehörden war, dass sie Frauen nichts als rechtsextreme Täterinnen wahrgenommen, sondern als Mitläuferinnen verharmlost haben. Dabei war gerade Beate Zschäpes Rolle für den NSU zentral, da sie dazu beitrug, die bürgerliche Fassade zu wahren. Muss hier nicht dringend ein Umdenken stattfinden?
Rechtsextreme Frauen müssen als Gefahr wahrgenommen werden. Sie kommen oft so nett, freundlich und fürsorglich daher – sei es nun in Kitas oder in Kleingartenkolonien, die ich oft besuche. Und genau das ist das Gefährliche: Sie sind eben nicht nur Mitläuferinnen, sondern haben zentrale Funktionen. Viele Ermittlungsbehörden erkennen das nicht – und sie erkennen rechtsextreme Frauen nicht, weil ihnen das Wissen über entsprechende Symbole fehlt. Dieses Wissen erwarte ich aber von ihnen.
Sie selbst sind nicht nur SPD-Obfrau im Untersuchungsausschuss, sondern haben auch für ein Theaterstück zum NSU auf der Bühne gestanden und beteiligen sich an zahlreichen Podiumsdiskussionen und Gesprächen zum Thema Rechtsextremismus. Hat die Arbeit im Untersuchungsausschuss ihren Blick auf das Problem verändert?
Ich hatte schon immer ein Bewusstsein für Rassismus und Rechtsextremismus, aber der Blick wurde natürlich noch einmal geschärft. Nun muss ich fast aufpassen, dass ich nicht überall Nazis sehe, wenn ich durch die Stadt gehe. Ich bin sehr sensibel geworden, was despektierliche Bemerkungen in meinem Umfeld angeht. Hier dürfen wir alle nicht weghören, sondern müssen in den entsprechenden Situationen etwas sagen.
Sagen Sie denn immer etwas?
Immer.
Das Gespräch führte Alice Lanzke.
Mehr Infos:
NSU-Abschlussbericht: Die bittere Lehre (netz-gegen-nazis.de)“Heute ist nicht der Tag des großen Abhakens“: NSU-Nebenklagevertreter kritisieren Abschlussbericht (netz-gegen-nazis.de)TV-Tipp: „Staatsversagen – Der NSU-Ausschuss und die schwierige Aufarbeitung“ (netz-gegen-nazis.de)Nur eine Bagatelle? Wie der Staat den Rechtsextremismus verharmlost (netz-gegen-nazis.de)


