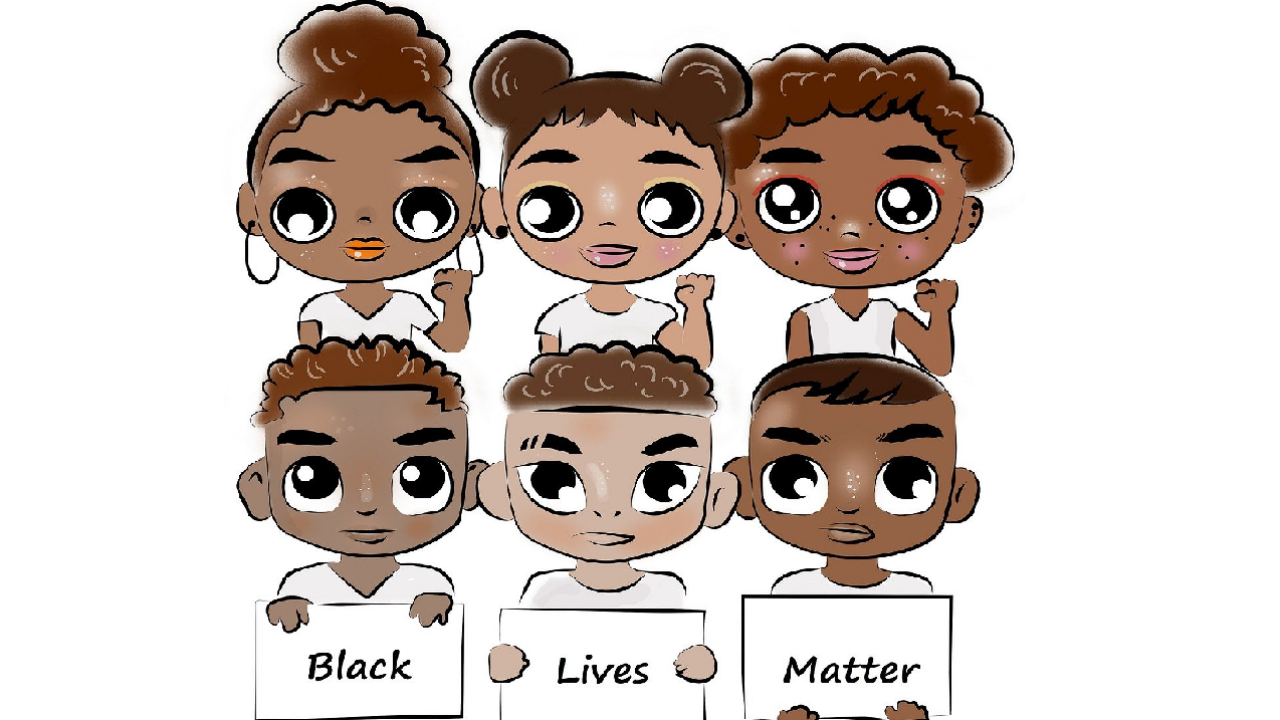
White Gaze
Du spürst die Antipathie, noch bevor die Antagonist:innen zum Wort greifen. Es ist schon der Blick, der angestrengte, nicht selten auch angewiderte Blick. Der White Gaze hat dich erfasst. Deine Visage ist ins Visier einer Völkergemeinschaft geraten, die dir skeptisch gegenübersteht, auch wenn sie von deiner Anwesenheit längst profitiert.
Schaust du weg oder nach unten, bestätigst du damit deine Schuld. Blickst du hingegen mit stolzen Augen zurück, lässt dich dieser erschwerende Umstand als eine erhöhte Bedrohung interpretieren. Setzt du zwecks Entwaffnung ein Lächeln auf, wirst du als kindlich-unterwürfig eingeschätzt, wobei du höflicherweise ein bisschen mehr Platz machen und deinen Hut antippen könntest. Aber auch dann, auch wenn du in einem Anfall der Selbstverachtung den Onkel Tom oder die Tante Jemima zum Besten geben würdest, käme man nicht auf die Idee, dir mit Empathie, geschweige denn Respekt, zu begegnen.
Das sind keine Ausnahmeerfahrungen. Nein, wenn du als Schwarze Person in einer weißen Dominanzgesellschaft unterwegs bist, ist das dein Alltag. Ganz egal, ob in Berlin, Birmingham, Boston oder Brisbane. Die Leitkultur kann dich wie aus heiterem Himmel blitzartig erkennen lassen, dass du mitsamt deiner ganzen Diaspora beliebig ausgegrenzt bzw. eingezäunt werden dürftest, könntest oder solltest. Deine Hautfarbe ist der primäre Grund dafür, dass „Einheimische“ es sich gestatten, deine vermeintliche oder auch tatsächliche Herkunft zu thematisieren und dir somit zu verstehen geben, wo du ihrer Meinung nach wirklich hingehören würdest. Ausweis hin, Ausweis her.
Othering als Abwertung
In jeglicher rassifizierten Gesellschaft dient die Hautfarbe zum „Othering“, d.h. zur Distanzierung der Gruppe, der man sich zugehörig fühlt, von jenen Gruppen, die man als minderwertig abstempelt. Diesbezüglich sprechen wir vom „Colorism“ (auch „Shadeism“ genannt), einem kruden, wiewohl komplex ausgearbeiteten Konzept. Colorism beschreibt die bevorzugte oder benachteiligte Behandlung von Personen je nach Hautschattierung. In der weißen Leitkultur werden Menschen mit dunklerer Hautfarbe strukturell diskriminiert, sogar de facto dämonisiert. Doch damit nicht genug: Das besonders perfide am Colorism ist, dass er zwischen und sogar auch innerhalb jeweils rassifizierten Gruppen auftritt. In der Schwarzen Community, wie in anderen ethnischen Gemeinschaften, sorgt dies also für zusätzliche Spannungen, die den Kampf gegen den Rassismus unnötig beeinträchtigen.
Schönheitsideale und Schutzfaktoren
Es war die afroamerikanische Schriftstellerin und Pulitzer-Preis-Gewinnerin Alice Walker, die den Begriff Colorism so prägte. Ihn definierte sie als die „verinnerlichte Präferenz für europäische physische Merkmale seitens Afroamerikaner:innen, wie helle Haut und glattes Haar“. Walker, vor allem als Autorin des 1982 veröffentlichten, später verfilmten Romans The Color Purple bekannt, befasste sich eigentlich schon 1973 mit dem Sujet, und zwar in ihrer Kurzgeschichte Everyday Use. Diese handelt von der problematischen Beziehung zwischen den Geschwistern Maggie und Dee, die von einer alleinerziehenden Schwarzen Mutter aus dem Süden der USA geboren wurden. Während Dee eine hellere, leidlich blass anmutende Haut hat, ist Maggies Haut dunkel, ja schokoladenbraun. Dee kommt wesentlich selbstbewusster und weltgewandter vor als Maggie.
Die Farbe der Haut ist schon lange ein Community-Thema
Toni Morrison, die erste Schwarze Literaturnobelpreisträgerin, widmete sich auch etliche Male dem Thema Teint. Ihr Debütroman The Bluest Eye (1970) porträtiert das Schwarze Hausmädchen Pecola Breedlove, das inbrünstig darum betet, blaue Augen und einen blonden Schopf zu erhalten. In Morrisons mehrdeutig betitelter Geschichte Tar Baby (1981) lernt man Jadine kennen, ein beliebtes afroamerikanisches Model, deren helle Haut ihr Verhältnis zu einem dunkelhäutigen Schwarzen belastet. Morrison’s Erzählung God Help the Child (2015) zeigt uns Sweetness, eine Frau, die sich selbst als „hellhäutig mit gutem Haar, was wir als hohes Gelb bezeichnen“ preist und, zu ihrem großen Bedauern, ein Kind mit sehr dunkler Haut zur Welt bringt. Sweetness schildert: „Es dauerte nicht länger als eine Stunde, nachdem sie sie zwischen meinen Beinen hervorgezogen hatten, bis ihnen klar wurde, dass etwas nicht stimmte. Wirklich falsch. Sie war so Schwarz, dass sie mir Angst machte. Mitternachtsschwarz, Sudanesenschwarz.“
Auch die A-Prominenz der dark-skinned Frauen wird nicht geschont. Siehe Amanda Gorman. Die junge afroamerikanische Dichterin, deren – nun in Florida gebanntes – Gedicht The Hill We Climb (2021) Abermillionen Menschen bei der Amtseinführung von Joe Biden gerührt hat, wurde kurz nach ihrem Bravourstück in Washington von einem zivilen Wachmann auf Schritt und Tritt gefolgt. Er hielt sie an und überprüfte sie, weil sie „verdächtig“ ausgesehen habe.
Die Tennis-Legenden Venus und Serena Williams, die mehrfach mit Gold gekrönte Turnerin Simone Biles und auch die Ex-Präsidentengattin Michelle Obama werden mit dem weißen Blick auf ihr Aussehen reduziert und exotisiert. Muskulöse Arme und Beine? Weiße bzw. hellhäutige Frauen, die jene Eigenschaften aufweisen, werden als athletisch gefeiert. Dunkelhäutige Schwarze Frauen, die so sportlich vorkommen, werden jedoch eher als animalisch und maskulin angesehen. Als Michelle Obama von ihrer Nachfolgerin Melania Trump im Weißen Haus abgelöst wurde, schrieb die weiße NGO-Direktorin Pamela Ramsey Taylor online: „Endlich eine erstklassige First Lady und kein Affe in Stöckelschuhen“. Taylor ist zum Glück nicht mit einem blauen Auge davon gekommen. Zum einen verlor sie ihren Job. Zum anderen wurde die 57-Jährige Facebook-Userin zu zehn Monaten Gefängnis verurteilt, allerdings nicht wegen Rassismus, sondern weil sie zugegeben hatte, Geld veruntreut zu haben. Karma ist auch für Karen ein Bumerang.
Toxische Vorlieben
Ungeachtet dessen bleichen viele dunkelhäutige Frauen ihre Haut regelmäßig mit Cremes und Seifen, die toxische Substanzen wie Hydrochinin und Quecksilber enthalten. Die giftigen Bestandteile können Dermatitis verursachen, Krebs auslösen und Gehirn-, Leber- und Nierenschäden hervorrufen. Nicht minder besorgniserregend ist die Tatsache, dass dieses Phänomen ausgerechnet in längst unabhängigen afrikanischen Ländern verbreitet ist. Circa 30 Prozent der Frauen in Senegal und Südafrika verwenden solche Produkte. In Togo sind es um die 60 Prozent, in Nigeria sage und schreibe rund 80 Prozent, Tendenz jeweils steigend. Die Weltgesundheitsorganisation (W.H.O.) schlägt Alarm.
White-Facing ist eine globale Wachstumsindustrie. Die Nähe zum Weißsein gilt als die Nähe zur reinen Schönheit verkauft und verstanden. Das ist allerdings kein Trend, sondern eine Tradition, vor der auch Schwarze Männer nicht gefeit sind. In meinem Essayband Race Relations beschreibe ich, wie der Weltstar Nat King Cole sich vor seinen Fernsehauftritten etliche Töne heller schminken ließ.
»Auch [Nat King Coles] privates Leben war vom Colorismus gefärbt und gleichsam überschattet. Seine zweite Gattin Maria, eine hellhäutige Afroamerikanerin, entstammte einer Elitefamilie Bostons. Unter dem Namen „Marie Ellington“ hatte Maria früher als Sängerin gearbeitet, und zwar im Duke Ellington Orchestra, wobei sie mit dem legendären Schwarzen Bandleader nicht verschwägert war. Den Nachnamen „Ellington“ hatte sie von ihrem ersten Mann Spurgeon Ellington, einem ebenfalls hellhäutigen Afroamerikaner, der 1943 als Bomberpilot ums Leben gekommen ist. Scheinbar hat Maria den ebenholzartigen Teint ihres famosen Gatten Nat als etwas Bedauerliches empfunden. Das bestätigte ihre gemeinsame Tochter, die preisgekrönte Vokalistin Natalie Cole (1950–2015), die zudem darüber berichtete, dass Maria es nicht ausstehen konnte, wenn Natalie und ihre Geschwister mit Schwarzen Kindern spielten.«
Der Praktik des Aufhellens wohnt also nicht lediglich ein ästhetischer Aspekt inne. Nein, die Kosmetik geht mit dem Klassismus einher. Soul & Haben, so pflege ich mit meiner gleichnamigen Ballade diese emotionelle Zwickmühle zu nennen. Die Schönheit hängt direkt mit der sozialen Schicht zusammen, da Menschen, die über mehr Geld verfügen, die Möglichkeit haben, an ihrem Aussehen zu arbeiten. Also Schönheit und Schein?
Gefährdungsfaktor
Es geht schließlich auch um die eigene Sicherheit. Schwarze, die heller aussehen, wenn alles andere gleich bleibt, dürfen damit rechnen, seitens der weißen Dominanzgesellschaft etwas weniger belästigt, belastet, kontrolliert und karikiert zu werden. Das Aufhellen für Schwarze, die „im Freien“ unterwegs sind, ist wie das Eincremen für Weiße, die es vorhaben, in der prallen Sonne herumzulungern. Man creme sich mit etwas ein, das einen hohen Schutzfaktor verspreche. Wahrhaftig gilt, je dunkler die Hautfarbe, desto höher die Gefährdung. Für die Gesellschaft – und sowieso für den Direktbetroffenen.
Dunkelhäutige Schwarze wie Eric Garner († 2014), Michael Brown († 2014), Breonna Taylor († 2020) und George Floyd († 2020) werden häufiger von der Polizei getötet, auch wenn sie bei der oft fragwürdig begründeten Festnahme gar keinen Widerstand leisten. Im Polizeifunk lachen und lästern Beamte über „King Kong“ und prahlen, als würden sie Bestien im Dschungel umlegen. Man weiß, wer damit gemeint wird.
„RACE“ und das Schwarzweißdenken
Angesichts dieser verheerenden Folgen ist es klar, dass der Colorism bekämpft werden muss. Doch wie? Einerseits obliegt es uns, gegen dieses Übel als einen integralen Bestandteil des Rassismus zu Felde zu ziehen. Das tun wir wohl, da es ohne Rassismus keinen Colorism gäbe.
Andererseits ist es vonnöten, dass wir uns speziell auf die lange ignorierten Bedürfnisse unserer Brüder und Schwestern fokussieren. Das tun wir auch. Wir bieten seelische Versorgung durch Professionelle aus der eigenen Community an, um den rassismus-basierten traumatischen Stress, die Betroffene heimsucht und teils wortwörtlich lähmt, konsequent zu kontern. Wir stellen unsere eigenen Produkte für afro-texturiertes Haar her. Wir treten mit Workshops in Erscheinung, die unser Melanin als Element der Schwarzen Schönheit zelebrieren und Selbstliebe sowie Körperpositivität fördern. So weit, so gut. Denn der Krieg muss an etlichen Fronten geführt werden.
Dennoch gibt es innerhalb der Schwarzen Community einen besorgniserregenden Ansatz, der droht, den Zusammenhalt zu zerreißen. Diesen Ansatz nenne ich Radical Anti-Colorism Exclusionism (RACE). Demzufolge werden wir Schwarzen, die man nolens volens zu den light-skinned Blacks zurechnet, auf radikale Weise aus der Lösungssuche zum Colorism ausgeschlossen. Denn wir seien Teil des Problems.
Diese verletzende Kritik kenne ich schon zur Genüge aus der Kindheit. Aber jüngst erlebte sie auf einer Berliner Veranstaltung zum Schwarzen Empowerment aufs Neue. Als ich auf meinen Auftritt wartete, hörte ich, zunehmend irritiert und teils staunend, meiner Vorrednerin zu. Die Youtube-Influencerin implizierte im Wesentlichen, dass hellhäutige Schwarze nicht Schwarz genug seien, um über den Schmerz des Rassismus mitzureden.
Verletzende Vorwürfe
Ich erhob Einspruch und erwähnte, dass meine hellhäutigen Urgroßeltern Versklavte in Tennessee gewesen waren. Mein Ziel war, meinen Zugang zum Thema zu offenbaren und für inklusive Perspektiven zu plädieren. Doch die Influencerin stempelten diese Erwähnung sogleich als Whataboutism ab, als wollte ich den Rassismus „wie eine weiße Person“ relativieren. Daraufhin fragte ich sie, wo und wie sie die Linie zwischen light-skinned und dark-skinned Blacks denn ziehen würde. Um so etwas zu vollbringen, müsste sie nicht die pseudowissenschaftliche „Rassenkunde“ wieder heranführen? Bräuchten wir noch mehr arbiträr und oberflächlich festgelegte Kategorien der Menschentype? Und was hätte sie zur „One Drop Rule“ zu sagen? Demgemäß galt in den USA jede Person als Schwarz, die mindestens zu einem Achtel Schwarzes Blut aufwies. Meinen Fragen wich die Referentin aus. Stattdessen hackte die Moderatorin der öffentlich finanzierten Veranstaltung nach. Aber gegen mich. Ich, eine von Neonazis und TERFs angefeindete Schwarze trans* Frau, solle lieber meine „Privilegien“ als Hellhäutige aufzählen, hieß es.
Wer in meiner Haut steckt, vermag mein Entsetzen zu verstehen. Meine Ahnen stammten sowohl mutter- als auch väterlicherseits aus Afrika. Es ist ein halbes Millennium her, als sie angekettet und wie Vieh westlich über den Atlantik verschifft wurden. Über die Jahrhunderte hinweg erlangten wir eine stets hellere Hautfarbe, weil die versklavten Frauen mehrfach vergewaltigt wurden. Die dadurch gezeugten Kinder gerieten in die lebenslängliche Knechtschaft. Hellhäutige Versklavte dürften zwar im Hause des Plantagenbesitzers arbeiten und wohnen, aber dafür wurden sie weitaus häufiger sexuell missbraucht. Hinweis: Zugang bedeutete also nicht gleich Zuflucht. Das gilt auch heute.
Als ich im Schatten der Freiheitsstatue das Licht der Welt erblickte, wurde ich der Kategorie der Negroiden zugerechnet, wie auch meine 1961 ebenda in den USA ausgestellte Geburtsurkunde mit dem Vermerk „Race: Negro“ dokumentiert. In der Tat weise ich, trotz meiner hellen Hautfarbe, die phänotypischen Merkmale ebenjener Kategorie auf. Unter anderem krause Behaarung, fleischige Lippen und eine etwas breite Nase. Ich bin Schwarz und verdammt stolz, Schwarz und verdammt strapaziert. Schwarz und verdammt halt. Allerdings lasse ich mir mein Schwarzsein nicht absprechen.
Wem nützt eine Trennung?
Nach meiner Widerrede erhielt ich vor Ort und online viel Zuspruch von hellhäutigen Schwarzen, die zeitlebens diese „doppelte Diskriminierung“ am eigenen Leibe erfahren. Besonders bewegend war allerdings die starke Solidarität, die ich von dark-skinned Blacks bekam. Das war aber nicht überraschend. Denn der exklusionistische RACE-Ansatz ist in der Community zum Glück nicht mehrheitsfähig. Doch er dient der White Supremacy, so nach dem Prinzip divide et impera. Das Farbton-Policing sabotiert unser Fortkommen. Seine Verfechter:innen argumentieren an der Geschichte vorbei, klammern die Intersektionalität aus und fördern mit bedenklich biologistischen Ansichten den Ableism und die Transfeindlichkeit. Anstatt dessen sollten wir uns darauf zurückbesinnen, unsere Vielfalt in allen wunderbaren Nuancen zu würdigen.



