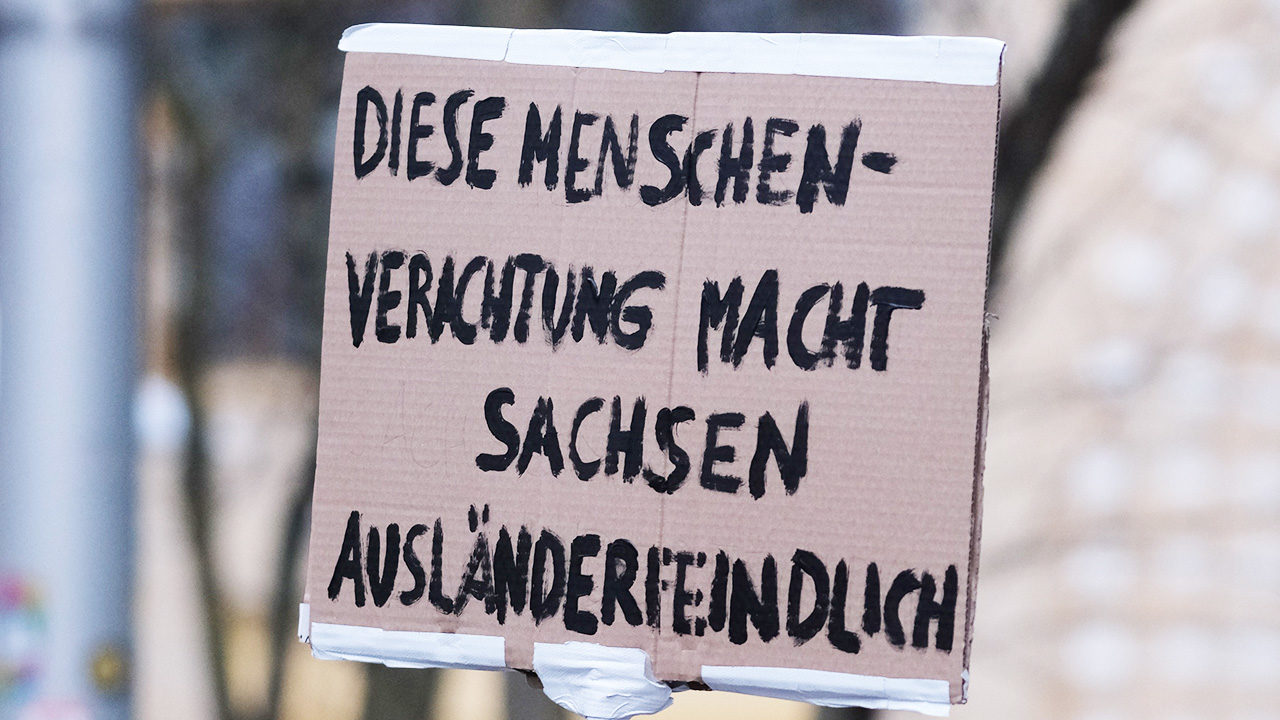1991 floh die damals erst zweijährige Hami Nguyen mit ihrer Mutter von Vietnam nach Deutschland, wo ihr Vater als Vertragsarbeiter in der DDR gearbeitet hatte. Heute arbeitet sie als Bildungsreferentin bei der Bildungsstätte Anne Frank. Im Herbst erscheint ihr Buch „Das Ende der Unsichtbarkeit – Warum wir über anti-asiatischen Rassismus sprechen müssen“. Sie verarbeitet darin ihre rassistischen Erfahrungen in Deutschland und erzählt von einer Kindheit, die von Armut geprägt war.
Wir trafen Hami auf der Re:publica in Berlin und sprachen mit ihr über das Thema „Cash“.
Belltower.News: Hallo Hami. Erzähl mal, was war dein erster Gedanke, als du erfahren hast, dass das diesjährige Re:publica-Thema „Cash“ lautet?
Hami: Ich fand es zunächst total gut. Es ist ein sehr komplexes Thema, vor allem, wenn wir an Klassismus denken; eine Diskriminierungsform, die meines Erachtens noch viel zu wenig Beachtung in öffentlichen Diskursen findet.
Kannst du uns erklären, was Klassismus ist?
Kurz gesagt: Die Unterdrückung von Menschen in Armut. Eine Diskriminierungsform, die besonders für Kinder schwerwiegende Folgen hat. Wo wir gerade dabei sind: Richtig geärgert hat mich ein Talk von Bundesfinanzminister Christian Lindner. Er hat ja auf der Re:publica gefordert, wir müssen in die Zukunft investieren. Und ich finde es spannend, dass er die Kindergrundsicherung dabei überhaupt nicht erwähnt hat. Schließlich war es ja seine Partei, die FDP, die sie blockiert hat.
Ich spreche aus Erfahrung, denn auch ich bin in Armut aufgewachsen. Ich kann also darüber sprechen, wie sich Armut auf mich ausgewirkt hat. Es gibt zudem ja auch zahlreiche Studien über die Auswirkungen von einem Leben in Armut.
Was sind denn die Auswirkungen?
Laut der letzten Studie der Bertelsmann Stiftung gelten mehr als jedes fünfte Kind und jeder vierte junge Erwachsene in Deutschland als armutsgefährdet. Eine der Auswirkungen: Betroffene Menschen leiden unter ständigen Existenzängsten. Diese Ängste bleiben auch dann, wenn sich die Bedingungen gebessert haben, wenn die Person nicht mehr in Armut leben. Aus dieser Existenzangst, in die so viele Menschen hineingeboren werden, kommt man auch im Erwachsenenalter nur kaum oder nur sehr schwer wieder raus, da das Vertrauen in die Gesellschaft und damit in eine sichere Zukunft nicht oder nur bedingt aufgebaut wurde.
Welche Rolle spielt hier Bildung?
Beim Thema Kinderarmut kommt erschwerend hinzu, dass oft einfach Infrastruktur und Zugänge zur Bildung fehlen. Wenn man bedenkt, dass auch berufliche Aussichten mit dem sozialen, kulturellen und natürlich ökonomischen Kapital der Eltern zusammenhängen, haben Kinder, die in Armut aufwachsen, schlichtweg viel schlechtere Startbedingungen. Das ist einfach ungerecht und ist ein Zeichen eines kapitalistischen Klassensystems.
Ein riesiges Problem, das die Politik also dringend angehen müsste. Stattdessen vergrößert sich die Kluft zwischen Arm und Reich.
Armut ist ein strukturelles Problem und damit eines, das politisch und gesamtgesellschaftlich angegangen werden muss. Obwohl das diesjährige Thema auf der Re:publica „Cash“ ist, habe ich das Thema Klassismus bisher eher als randständig wahrgenommen. Das ist schade. Viel geht es hier um Finanzsysteme und neues Geld, wie Bitcoin. Aber wer kann es sich heute überhaupt leisten, in Bitcoins zu investieren? Und wer kennt sich mit diesen Themen überhaupt aus? So viele Menschen fallen da einfach raus.
Dass das riesige Problem Klassismus generell so wenig Beachtung findet, liegt ja vielleicht auch daran, dass es einfach keine so starke Lobby in dem Bereich gibt, oder?
Ja, genau. Und das ist ein weiteres Problem. Viele Menschen mögen sich hier einfach nicht öffentlich positionieren – schließlich ist Armut mit sehr viel Scham verbunden. Wer gibt denn schon gerne freiwillig zu, dass sie arm ist? Vielmehr ist es ja auch so, dass arm sein gesellschaftlich stigmatisiert wird.
Ein bestimmter armer Style gilt aber auch als trendy?
Ja, das schon. Ich beobachte, dass dieser Style dabei hauptsächlich von Menschen getragen wird, die scheinbar keine existenziellen Sorgen haben. Sie können es sich leisten, arm auszusehen, schließlich können sie diesen Style jederzeit ändern. Echte Armut kann man nicht einfach ablegen.
Deine Mutter hat euch Kindern damals die Kleidung teilweise aus der Kleidersammlung besorgt. Wie war das für dich?
Mir war das sehr peinlich als Kind. Dabei war es meiner Mutter immer besonders wichtig, dass wir ordentlich und sauber aussahen. Wir hatten zwar nichts, aber das sollte man uns wenigstens nicht ansehen. Wenn wir in der Kleidersammlung oder auf dem Sperrmüll Markensachen, wie Adidas oder Nike gefunden haben, mussten wir mit diesen Dingen besonders sorgfältig umgehen. Viele richtig reiche Menschen legen heute ja gar keinen Wert mehr darauf, Marken sichtbar zu zeigen. Für arme Menschen, oder Menschen, die in ökonomisch prekären Verhältnissen aufgewachsen sind, sind Marken schon ein wichtiges Thema.
Das Zeigen von Marken wird dann als Zeichen eines gesellschaftlichen Aufstiegs gedeutet?
Ja, vielleicht, aber auch nur teilweise. Generell ist es einfach gesellschaftlich verpönt, arm zu sein. Insbesondere, weil wir ja in einer neoliberalen Gesellschaft leben. Viele glauben immer noch an die Erzählung, jede*r könne es aus der Armut schaffen und sozial aufsteigen, wenn sie*er sich halt nur genug anstrenge.
Was ist denn dran, an der Erzählung vom Aufstieg?
Arme Menschen oder Menschen, die der Unterschicht angehören, haben oft prekäre Jobs, müssen sehr viel arbeiten und haben gar keine Zeit dafür, um sich mit gesellschaftspolitischen Themen auseinanderzusetzen. Auf Veranstaltungen, wie der Re:publica, werden Menschen entweder dafür bezahlt hier zu sein oder sie haben die Möglichkeit sich drei Tage frei zu nehmen und das Geld für ein Ticket, um dabei zu sein. Eine alleinerziehende Kassiererin kann sich höchstens die Talks in ihrer knappen freien Zeit auf YouTube anschauen.
Kannst du uns noch was zum Verhältnis von Klassismus und Rassismus erzählen?
Es gibt rassifizierte Menschen oder Menschen mit Migrationsgeschichte, die in prekären Verhältnissen leben, zum Beispiel weil sie keine sicheren Aufenthaltstitel haben. In meinem Fall war es so, dass meine Eltern nur eine Duldung hatten und keine Arbeitserlaubnis. Das heißt, sie durften nicht arbeiten gehen, von Geld ansparen war erst gar keine Rede. Ein weiteres Beispiel ist struktureller Rassismus in Form von Arbeitsplatzdiskriminierung, die auch zu monetären Einbußen führen kann.
Um nochmal auf die Re:publica zu kommen: Welche Chancen siehst du in solchen Veranstaltungen?
Beim diesjährigen Thema „Cash“, hätte eine intersektionale Ausrichtung viel Potenzial gehabt. Konkret hätte man die Themen breiter aufstellen können und entsprechende Speaker*innen einladen oder Workshops anbieten können. Günstigere Tickets oder sogar ein bestimmtes Kontingent an Freikarten für Menschen, die keine Möglichkeit haben sich das zu leisten. Veranstaltungen, die sich gesellschaftlichen Fortschritt auf die Fahne schreiben, müssen inklusiver werden und damit meine ich auch über Klassen hinweg.
Hier gehts zum Buch von Hami: https://www.ullstein.de/urheberinnen/hami-nguyen