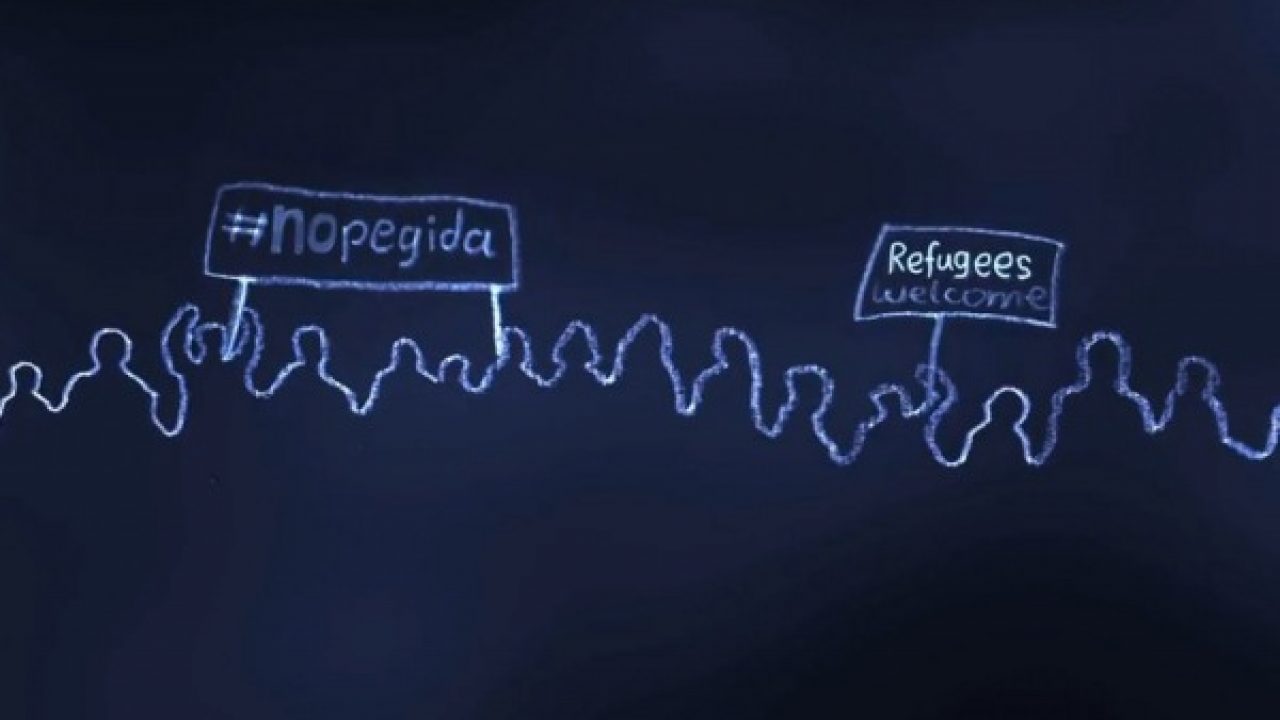Belltower: Letzte Woche, am 02.03.2020, fand in Berlin im Kanzleramt der 11. Integrationsgipfel statt – auch Sie waren anwesend. Vorab war bekannt, dass vorrangig über die erste „Phase“ eines Integrationsplans gesprochen werden solle. Hat der rassistische Anschlag in Hanau die Themensetzung beeinflusst?
Ataman: Die Bundeskanzlerin und der Innenminister haben vor dem Integrationsgipfel zu einem Gespräch mit Migrant*innenorganisationen eingeladen, bei dem wir über den rechtsterroristischen Anschlag in Hanau gesprochen haben. Beim Gipfel selbst ging es tatsächlich fast nur um die „Vorintegration im Herkunftsland“, was ganz unabhängig von Hanau eine merkwürdige Schwerpunktsetzung ist. Viele Migrant*innenorganisationen und Neue Deutsche Organisationen, also von Menschen der 2. und 3. Generation, fordern seit Jahren einen stärkeren Fokus auf Rassismus und Diskriminierung in diesen Dialogrunden. Wir wollen nicht mehr hauptsächlich über Sprachkurse sprechen. Zahlreiche Migrant*innenorganisationen haben gefordert, aus der Fachkommission „Integrationsfähigkeit“ einen ständigen Partizipationsrat Einwanderungsgesellschaft zu machen, der nach dem Modell des Deutschen Ethikrats beim deutschen Bundestag angesiedelt ist.
Generell scheint sich die Politik nur selten mit dem Rassismus gegenüber Deutschen mit Migrationsgeschichte zu beschäftigen. Das Thema Rassismus wird meistens direkt mit Einwanderung verknüpft. Wird der strukturelle Rassismus durch eine solche Einordnung verstärkt?
Ja, wenn so getan wird, als sei Rassismus eine Reaktion auf Fluchtmigration, ist das ein falsches und problematisches Framing. Rassismus gibt es auch in Zeiten, in denen es mehr Auswanderung aus als Einwanderung nach Deutschland gibt, wie zum Beispiel um das Jahr 2007 der Fall. Wenn aber Migration in den Debatten als Ursache für Rassismus hergenommen wird, bestärkt es einige darin, ihren Rassismus offen auszuleben – quasi als Selbstschutz. Und das passiert öfter, als man glauben mag: Sogar nach dem rechtsextremen Mord an CDU-Politiker Walter Lübcke gab es viele Kommentare, die sagten, Lübcke habe die Leute eben provoziert mit seinen flüchtlingsfreundlichen Worten.
Welche Strategien gegen strukturellen Rassismus würden Sie sich wünschen?
Wir brauchen grundsätzlich mehr Wissen über Rassismus in diesem Land, vor allem über seine strukturelle Verankerung in Gesetzen, Behördenabläufen, im Bildungswesen, auf dem Arbeitsmarkt und in den Alltagssituationen. Die meisten Menschen denken fälschlich, Rassismus hätte nur etwas mit Nazis zu tun. Auch das ist Teil unseres Problems, dass völkische Einstellung nur am äußersten Rand vermutet werden, während über die Hälfte der befragten Menschen in einer repräsentativen Umfrage zustimmen, dass sie sich „wegen der vielen Muslimen“ „fremd im eigenen Land“ fühlen. Also ist es dringend notwendig, dass die Menschen im Land – auch Linke und Leute aus der politischen Mitte – sich selbstkritisch mit Rassismus auseinandersetzen und offen sind für nachhaltige Veränderungen werden. Es reicht nicht, sich auf rassistische Gewalt zu konzentrieren und mit sicherheitspolitischen Maßnahmen zu antworten.
Halten Sie den Ausbau von Sicherheitsmaßnahmen wie polizeilicher Überwachung für angemessen, um rechtsextremen Terror zu bekämpfen?
Wenn das Bundeskriminalamt erklärt, bundesweit gerade einmal 53 Leute als rechtsextreme Gefährder einzustufen, klingt das nach einem schlechten Witz. Das Bundesamt für Verfassungsschutz zählt dagegen rund 25.000 Rechtsextremisten und geht davon aus, dass etwa die Hälfte „gewaltorientiert“ sind. Ich denke, wir sind uns alle weitgehend einig, dass Rechtsextreme stärker in den Fokus der Sicherheitsbehörden rücken müssen. Die entscheidende Frage ist, wie die Überwachung passiert, welche Konsequenzen das hat und ob die Empfehlungen aus dem NSU-Untersuchungsbericht endlich konsequent umgesetzt werden. Ebenso wichtig ist natürlich, wie gewährleistet wird, dass die Behörden gegen rechtsextremistische Strukturen in ihren eigenen Reihen vorgehen.
Von Rassismus betroffene Personen haben oftmals aus gutem Grund nur geringes Vertrauen in Polizei und andere Behörden. Welche Maßnahmen, abgesehen von mehr personeller Diversität, braucht es in den (Ermittlungs-) Behörden, um das Vertrauen zurückzugewinnen?
Polizei und Geheimdienste arbeiten viel mit dem, was der erste Eindruck hergibt, also mit Klischees und Stereotypen. Leute, die für Ausländer*innen gehalten werden, werden eher kontrolliert und ihre Aussagen misstrauischer aufgenommen. Racial oder ethnic profiling ist Alltag in Deutschland. Behörden betrachten dunkelhäutige Menschen primär als Täter und nicht als Opfer. Das sendet Signale aus, die über die Polizeikontrolle hinaus wirken. Es bestätigt rassistische Vorstellungen über „uns“ und die „kriminellen Anderen“ und spaltet die Gesellschaft weiter. Das Deutsche Institut für Menschenrechte empfiehlt: Die Führungsspitzen von Polizei und Innenministerien müssen klare Vorgaben an die Beamten machen, die sich aus den Grund- und Menschenrechten ergeben und racial profiling und die rassistische Täter-Stigmatisierung stoppen.
Bundeskanzlerin Merkel betonte auf der abschließenden Pressekonferenz des Integrationsgipfels, wie wichtig es sei, dass sich Minderheiten in Prozesse der Entscheidungsfindung einbringen. Diese Ansicht ist nicht neu und die Repräsentanz von Minderheiten trotzdem gering. Wie kann die Repräsentanz von Minderheiten auch tatsächlich umgesetzt werden?
Wir brauchen dringend mehr Repräsentation und ein Bewusstsein dafür, dass komplett weiße Gremien daneben sind und nicht mehr zeitgemäß. Wir haben zum Beispiel ein Bundeskabinett, in dem keine einzige Person wirkt, die selbst über Erfahrungen mit Rassismus verfügt. Das gilt auch für viele weiteren Funktionsebenen, die politisch besetzt werden. Da wir bereits im Jahr 2020 leben und sich freiwillig trotz jahrzehntelanger Debatten über Teilhabe und Diskriminierung wenig geändert hat, teile ich die Meinung vieler NGOs, dass es höchste Zeit ist für eine Debatte über verbindliche Quoten. Und wir brauchen Gleichstellungsdaten, um Fortschritte messen zu können. Das Projekt „Vielfalt Entscheidet“ erklärt, wie das gehen kann.
Ferda Ataman ist Journalistin und Publizistin. Sie engagiert sich in Vereinen für die Gleichstellung von Schwarzen Menschen und People of Color. 2019 hat sie auf Twitter unter #vonhier eine Debatte über Zugehörigkeit in Deutschland gestartet und die Streitschrift „Hört auf zu fragen. Ich bin von hier“ im s. Fischer Verlag veröffentlicht.