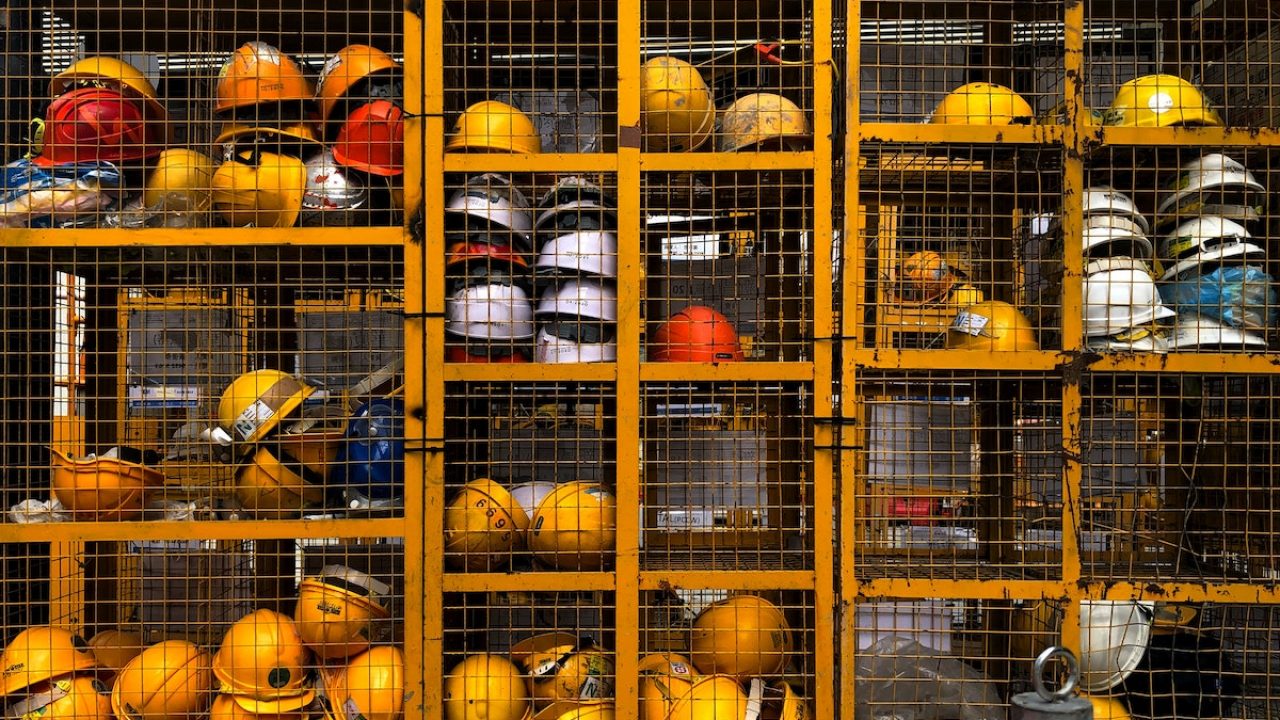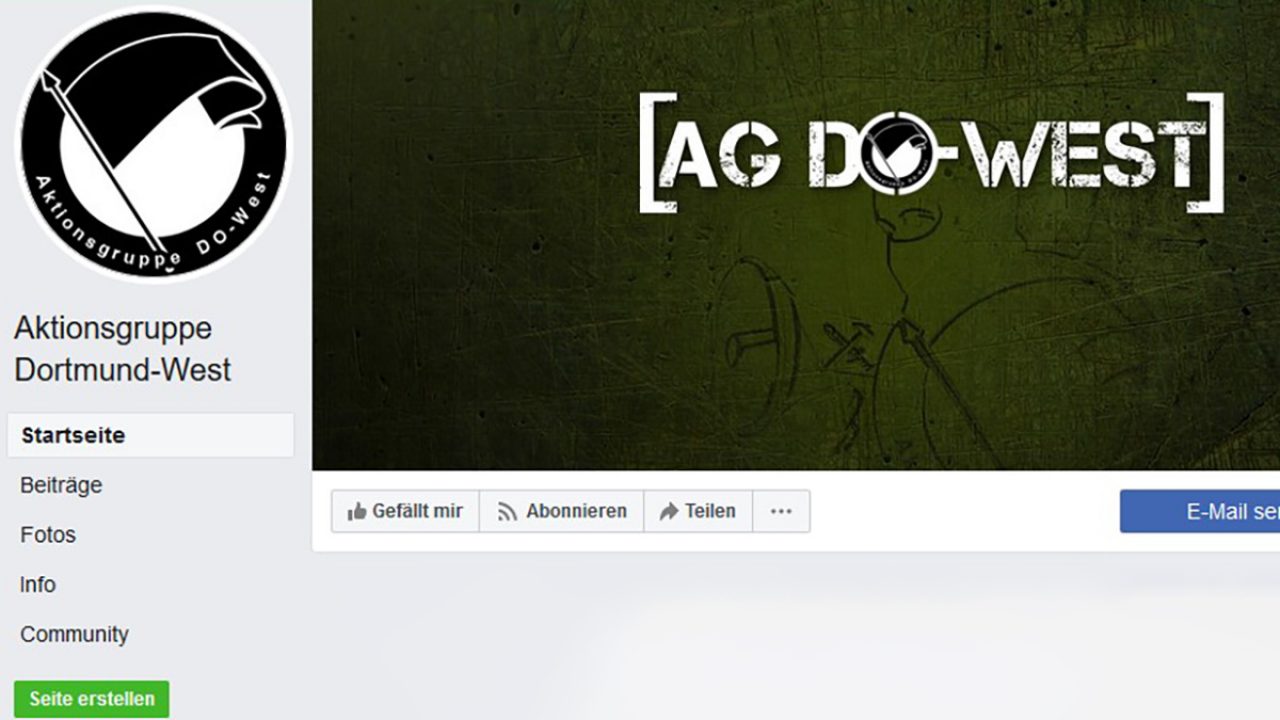Angela Merkel hat alles richtig gemacht. Sie hat von Rassismus in Deutschland gesprochen und davon, dass der Mord an den Einwanderern ein Anschlag auf uns alle war. Sie hat den historischen Kontext des Rechtsextremismus nicht unterschlagen und es als Schande bezeichnet, dass er sich ausgerechnet in Deutschland, dem Land des Holocaust wüten kann. Und sie hat die Angehörigen der Opfer endlich mit dem Respekt behandelt, den sie über Jahre so bitter vermisst haben. Bei der Trauerfeier hat man ihnen keine passive Rolle zugemutet; sie waren Teil der Veranstaltung, wie sie Teil der schrecklichen Ereignisse der Mordanschläge waren. Es wurde nicht über sie gesprochen, sie sprachen selbst.
Die Feier in ihrer Symbolik hatte etwas von dem, was wir uns in einer solchen Situation wünschen: Klarheit der Gedanken, Würde und Emotionen, die es erlauben, zu trauern. Seit dem Bekanntwerden der Morde bis zu diesem Moment gab es für Trauer keinen Raum. Zu lasch waren die Reaktionen in der Politik und Gesellschaft, zu unklar und halbherzig alle ergriffenen Maßnahmen. Zu unentschlossen die Ermittlungen und zu groß der Unwille, sich mit Rechtsextremismus und Rassismus zu beschäftigen, der sich nicht in der Einzeltat offenbart sondern im Alltag der Vielen, die nicht wahr haben wollen oder selbst bis zum Rand des erträglichen mit Rassismus angefüllt sind. Auch der emotionale Zustand der Republik gereichte dem Land nicht zur Ehre. Es gab ein individuelles Erschrecken über die Taten der NSU, das gewiss, doch daraus entstand kein Impuls, keine Wut, kein auf die Strasse getragener Wunsch nach Veränderung.
Wieso fällt uns nicht ein, was wir besser machen können
Die Trauerfeier sollte Impuls sein, dies alles nachzuholen. Wir alle müssen uns die Frage stellen, weshalb uns Phantasielosigkeit blockiert, wieso uns nicht einfällt, was wir besser machen können, damit die Milieus, aus denen die Täter kommen, keine Chance mehr haben, solchen Terror zu verbreiten, denn das tun sie vor unser aller Augen nach wie vor. Sie verbreiten Angst, sie schlagen zu und sie werden – das ist jedenfalls zu befürchten – auch weiter morden. Wieso ist das so? Nützt denn gar nicht, was die Initiativen für Demokratie bisher aufgebaut haben? Ist es denn überhaupt möglich, diese furchtbare Kultur der ewigen Abgrenzung und Ausgrenzung in Deutschland zu überwinden?
Wie würde ein Land handeln, das unseren Respekt im Umgang mit Rechtsextremismus und Rassismus verdienen würde? Welches wären die Maßnahmen in Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit, die eine neue Haltung gegenüber der sich ständig verändernden, offenen Gesellschaft in unserer globalisierten Welt deutlich machen? Sie würden auf Partizipation zielen und die und nichts anderes rigoros fördern und fordern! Sie würden Diskriminierungen offensiv bekämpfen, sie würden Gesetze formen, die dem Nachdruck verleihen, sie würden in der Öffentlichkeit jeden Tag klar machen, dass deutsche Identität, so es das überhaupt gibt, nicht von der Farbe von Haut und Haaren abhängt.
Rassismus heißt die Krankheit, der wir uns zu stellen haben
Es sich für ein anderes Land vorzustellen, das Beispiel sein könnte, soll aber nur eine Methode sein, uns aus der Starre zu befreien. Hier, in Deutschland müssen wir es angehen. Dahin, wo es weh tut, sollten wir sehen. Rassismus heißt die Krankheit, der wir uns zu stellen haben. Denn solange sie verleugnet wird, gibt es keine Gegenmittel. Das schaffen die Projekte und Initiativen nicht allein, dazu bedarf es eines politischen Willens, der mindestens ebenso stark sein muss, wie der aus der Atomenergie auszusteigen. Denn die Gefahr, die allen aus Rechtsextremismus und Rassismus erwächst, ist im Alltag allemal realer als die des atomaren „Restrisikos“. Sie gefährdet nicht in der Zukunft, sondern die Zukunft selbst. Sie riskiert nicht Menschenleben, sie tötet bereits jetzt.
Die Trauer um die Opfer rechtsextremer Gewalt, aller Opfer, wie die Kanzlerin sagte, ist kein Schlusspunkt. Nur wenn wir diese Trauer empfinden können, gibt es einen Weg die Verhältnisse zu ändern. Und dem Andenken der Toten gerecht zu werden.
Dieser Beitrag ist ursprünglich auf dem Portal „Mut gegen rechte Gewalt“ erschienen (2002-2022).