
Bildungs- und Aktionswochen gegen Antisemitismus: Herr Michel, Sie haben zwei Jahre ehrenamtlich in einer Geflüchtetenunterkunft im Rathaus Berlin-Wilmersdorf gearbeitet und über die Zeit das Buch „Wir machen das“ (2017) geschrieben. Ist Antisemitismus unter Geflüchteten ein Problem?
Holger Michel: Meine Perspektive auf Antisemitismus unter Geflüchteten beruht nicht primär auf Zahlen und Studien, sondern auf persönlichen Erfahrungen. Diese sind, dass antisemitische Vorurteile und antisemitisches Gedankengut bei vielen, ohne das in Zahlen zu nennen, vorhanden sind. Mein Eindruck ist allerdings, dass die deutsche Mehrheitsgesellschaft es sich gerne sehr leicht macht und sich, den Finger auf den „importierten Antisemitismus“ zeigend, reinwäscht. Dem widersprechen natürlich alle Zahlen. Antisemitische Einstellungen lagen in der deutschen Bevölkerung in den letzten Jahrzehnten konstant zwischen 8 und 12 Prozent. Es ist also Unfug zu behaupten, dass Deutschland bis 2015 quasi ein antisemitismusfreies Land war und dann ein Problem bekam. Allzu oft wird der Antisemitismus von Geflüchteten oder Menschen mit Migrationshintergrund thematisiert, ohne den eigenen Antisemitismus zu reflektieren. Das ist ein Problem.
Eine pauschale Antwort auf die Frage, ob Antisemitismus unter Geflüchteten ein Problem ist, gibt es aber nicht. Kann es auch nicht geben. Wer sind denn „die Geflüchteten“? Das ist doch keine homogene Gruppe. Dennoch haben wir zweifelsohne eine nennenswerte Anzahl geflüchteter Menschen mit antisemitischen Einstellungen. Meiner Erfahrung nach beruhen die sehr oft auf Unwissenheit, auch hervorgerufen durch die Nichtmöglichkeit, in der Heimat Zugang zu Wissen zu erhalten, was bei in Deutschland aufgewachsenen Antisemit*innen anders ist. Eine syrische Mitarbeiterin hat mir einmal erzählt, dass sie erst jetzt, mit fast 40 Jahren, hier in Deutschland zum ersten Mal etwas über die Ausmaße des Holocaust gelernt hat.
Um das Problem zu erfassen, müssen wir weiter differenzieren. Woher kommt die Person? Menschen aus dem Iran und Syrien haben sicherlich andere Einstellungen als Menschen aus anderen Ländern der Region. Daran schließt die Frage an, ob es sich um Judenfeindlichkeit oder um eine feindliche Einstellung gegenüber Israel handelt. Mit dieser Differenzierung mache ich mich bei einigen unbeliebt, ich halte sie aber für notwendig. Hier gehen Probleme, Vorurteile und Ablehnung zwar ineinander über, aber sie müssen unterschiedlich bearbeitet werden. Erwarte ich von jeder und jedem absoluten Respekt gegenüber Jüdinnen und Juden? Ja, ohne Wenn und Aber! Kann ich von jemandem, dem 30 Jahre lang in Syrien von der Propaganda eingetrichtert wurde, dass Israel die größte Bedrohung der Menschheit ist, erwarten, dass er nach Grenzübertritt plötzlich für das uneingeschränkte Existenzrecht Israels, das für mich natürlich nicht verhandelbar ist, eintritt? Nein. Wenn ich das aber immer gleichsetze, stehe ich in einer Sackgasse und kann gar nichts bewirken. Schritt eins: uneingeschränkter Respekt vor allen hier lebenden Menschen. Um Israel kümmern wir uns danach. Wobei auch da viel zu tun ist.
Es herrscht ja auch ein unglaubliches Unwissen über Israel. Als ich 2016 von einer Israel-Reise Fotos an Geflüchtete in Wilmersdorf schickte, glaubten die mir zuerst nicht, dass die Fotos aus Israel sind, weil da Moscheen auf den Bildern waren und sie doch gelernt haben, dass alle Moslems vertrieben wurden. Syrer*innen haben mich gewarnt, dort hinzufahren, weil das ein gefährliches Land sei. Das muss man sich mal vorstellen: Diese Menschen sind vor einem Bürgerkrieg geflohen und glaubten, Israel sei ein gefährliches Land. Unterm Strich kann man sagen: Die Ablehnung von Israel ist bei vielen sehr groß. Das ist hoch problematisch, aber das in der Arbeit mit Geflüchteten zu bearbeiten ist Schritt zwei.
Was haben Sie denn in dieser Geflüchtetenunterkunft gemacht? Wie kam es dazu?
Ich wollte im September 2015 einen Tag in der neueröffneten Geflüchtetenunterkunft helfen und bin dann nicht mehr weggekommen. Dort herrschte eine euphorische und zugleich bedrückende Stimmung mit vielen Helfenden, und die Frage war gleich „Was willst du machen?“ Am Ende habe ich bis zur Schließung zwei Jahre später geholfen. Die Situation war zu Anfang katastrophal. Es gab noch keinen Träger, und es war viel zu wenig zu essen da. Ohne Spenden wären da Kinder gestorben. Mitten in Deutschland, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir waren ein großes Team und haben täglich bis in die Nacht hinein geholfen. Ich habe zwischendurch meine Stelle reduziert und bin täglich nach der Arbeit nach Wilmersdorf gefahren. Ende 2015 wurde ich zum Sprecher der Initiative gewählt und war damit Ansprechpartner für Träger, Verwaltung, Politik und Medien.
Als Gruppe haben wir schnell angefangen zu überlegen, wie wir uns Integration vorstellen. In der gesellschaftlichen Debatte der Zeit wurden Antisemitismus, Homophobie und Sexismus immer in Zusammenhang mit den Themen Integration und Geflüchtete gebracht. Also haben wir uns dazu entschieden, diese Themen anzugehen. Für uns war die Frage: Was wollen wir für ein Bild von Gesellschaft in Deutschland vermitteln? Nicht unbedingt: Wie ist die deutsche Realität? Das ist ja auch ein Unterschied. So war zum Beispiel die Mehrheit der „Leitungsstellen“ bei den Freiwilligen mit Frauen besetzt, um klar zu machen: Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Beim Christoper-Street-Day haben wir über den Tag und die Aktionen rund um diesen Tag mit Flyern in zwölf Sprachen informiert. Wir hatten Freiwillige mit Behinderung, homosexuelle Freiwillige und Freiwillige mit Davidstern um den Hals. Und wir sagten: Willkommen, das ist das Deutschland, das wir wollen. Wer von uns gefördert werden wollte, der musste diese Regeln annehmen. Da wurde nicht verhandelt.
Wie lief das dann beim Thema Antisemitismus?
Zwei Monate nach der Eröffnung haben wir ein Pilotprojekt mit der Synagoge am Fraenkelufer gestartet. Wir hatten zwar festgestellt, dass das Thema Jüdinnen und Juden bzw. Antisemitismus viel irrelevanter war, als das medial dargestellt wurde, denn die Geflüchteten hatten konkrete, reale Probleme: neues Land, neue Sprache, Papiere, Behörden. Aber wir wollten uns dem Thema stellen, wollten klar machen, was wir erwarten. Und auch zeigen, dass das Bild von Jüdinnen und Juden ein anderes ist, als die Propaganda ihnen eingetrichtert hatte. Für deutsche Helfer*innen war das übrigens auch ganz gut, von denen hatten auch so einige ein falsches Bild.
Auch die jüdische Gemeinde hatte Sorgen, Vorurteile und Ängste, wie das mit einer Million überwiegend muslimischer Geflüchteter wird. Also war das Ziel: zusammenbringen, kennenlernen. An einem Tag sind dann rund 70 jüdische Helfer*innen gekommen, alle mit T-Shirts der Aktion, wo Davidsterne draufgedruckt waren. Da waren dann also 1.200 Geflüchtete, davon so 90 bis 95 Prozent muslimischen Glaubens, und 70 Personen mit Davidstern, mit Kippa. Wenn du damit aufgewachsen bist, dass das Monster sind, die dich alle töten wollen, und plötzlich stehen die in Sneakern vor dir und packen mit an, um dir zu helfen, dann brechen Gerüste zusammen. Das zu beobachten ist anstrengend, angespannt, manchmal auch einfach sehr unterhaltsam.
Unterm Strich haben wir als Initiative und auch die jüdische Gemeinde ein sehr positives Resümee gezogen. Die Idee war, sich kennenzulernen und gemeinsam zu interagieren. Und das hat geklappt. Ob beim Fußballspiel oder beim Aushelfen in der Kleiderkammer – plötzlich trafen keine gelernten Mythen, sondern Menschen aufeinander. Und die jüdische Gemeinde hat beispielsweise für uns Weihnachten gerettet, weil die meisten der Helfer*innen nicht in Berlin, sondern bei ihren Familien waren. 1.200 Bewohner*innen, ein paar wenige Helfer*innen und sehr viel Security – das ging nicht. Und da ist die jüdische Gemeinde eingesprungen.
Es sind durch dieses Projekt auch persönlich Beziehungen entstanden, die bis heute halten. Eine jüdische Helferin, Anna*, war vom ersten bis zum letzten Tag dabei. Sie trägt eine Davidstern-Kette. Sie sagt bis heute, dass sie nicht ein einziges Mal eine negative Reaktion auf den Davidstern vernommen hat. Die Leute haben viel gefragt, weil viele von ihnen überrascht waren, dass der vermeintlich „böse Jude“ hier war, um zu helfen. Aber sie hat nie eine Bedrohung oder negative Reaktionen erhalten. Und da ist natürlich die Frage, wann Antisemitismus beginnt. Ich wurde beispielsweise mal von einem Syrer gefragt, ob es stimmt, dass Juden in Deutschland keine Steuern zahlen müssen. Ist das Antisemitismus oder ein antisemitisches Vorurteil? Man kann diese Differenzierung Haarspalterei nennen, wenn ich aber gegen Antisemitismus kämpfen will, muss ich differenzieren. Die Frage ist absurder Quatsch, klar. Aber ich habe gerade die Möglichkeit, mit einem Vorurteil aufzuräumen. Ich finde, so lange Leute zwar solche Fragen stellen, mir aber die Möglichkeit geben, sie aufzuklären, ist das für mich kein Antisemitismus. Nur wenn die Person meine Antwort nicht gelten lassen und besseren Wissens darauf beharren würde, ist es Antisemitismus.
Es ist schwierig, über dieses Thema zu schreiben, ohne der Illusion des importierten Antisemitismus auf den Leim zu gehen, nach der die Geflüchteten Antisemitismus wieder nach Deutschland gebracht hätten. Man muss aber auch unbedingt De-Thematisierung vermeiden, bei der Antisemitismus unter Geflüchteten abgestritten wird. Wie thematisiert man dann Antisemitismus unter Geflüchteten?
Den muss man auf jeden Fall thematisieren, es gibt ihn, wir müssen ihn bekämpfen. Die Frage ist aber, wie wir uns dem Problem annähern. Gehen wir davon aus, dass jeder Muslim und jeder Geflüchtete automatisch eine Gefahr und eine Bedrohung für Jüdinnen und Juden darstellt? Ich wünsche mir, dass das Thema „heutiges Judentum in Deutschland“ verstärkt in den Integrationskursen behandelt wird. Ich plädiere nicht dafür, dass wir das mit Besuchen im Konzentrationslager abhaken. Da sehen sie dann nur tote Juden, aber nicht den Typen, der neben mir im Café sitzt und genauso aussieht wie ich.
Es gibt ja auch viel Kritik an dem Begegnungskonzept. In die Richtung gehend, dass Antisemitismus nichts mit dem wirklichen Verhalten von Jüdinnen und Juden zu tun hat, sondern Dinge oder Charaktereigenschaften damit auf sie projiziert werden. Oder dass Antisemitismus bestimmte Funktion erfüllt und mehr ist als ein aufzulösendes Vorurteil. Wenn das stimmt, kann die Begegnung vielleicht nicht so viel bringen.
Da hast du natürlich recht, das funktioniert nicht alleine. Wir hatten die Möglichkeit, ein solches Projekt zu starten, das können nicht alle. Ich habe in der Debatte um „Pflichtbesuche“ von Geflüchteten mal geschrieben, dass alle Geflüchteten mal Juden kennenlernen sollten. Ein jüdischer Freund sagte dann: „Nette Idee, aber weißt du, wie viel Juden und wie viele Flüchtlinge und Menschen mit Migrationshintergrund es gibt? Die sind zehnmal mehr. Schönen Dank, dann ist mein Kalender für immer voll.“ Fairer Punkt, auch ich lerne dazu. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass direkter Kontakt und vor allem das nicht Zur-Disposition-Stellen von gesellschaftlichen Normen dem Thema mehr helfen als KZ-Besuche, wenngleich ich denke, dass da jeder Mensch mal hinfahren müsste.
Ist das Thema Antisemitismus unter Geflüchteten noch aktuell im Jahr 2020?
Ja. Es ist ein Thema und wird auch immer Thema bleiben. Antisemitismus muss weiterhin beobachtet und Strategien dagegen entwickelt werden. Damit wir sinnvolle Lösungen finden, ist es wichtig, sich verschiedene Gruppen anzuschauen: Wenn wir über Geflüchtete reden, haben alle sofort Muslim*innen im Kopf. Unter den christlichen Syrer*innen waren die Vorurteile aber keineswegs geringer. Das ist auch ein nationales und nicht nur ein religiöses Problem.
Das Gespräch wurde im September 2020 geführt.
* Name von der Redaktion geändert.
Zivilgesellschaftliches Lagebild Antisemitismus
Das Interview ist ein Auszug aus dem „Zivilgesellschaftlichen Lagebild Antisemitismus“ der Amadeu Antonio Stiftung, dass heute erscheint: Eine zivilgesellschaftliche Bestandsaufnahme: Wie ist es 2020 um Antisemitismus in Deutschland bestellt?
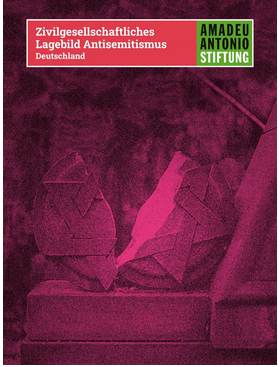
Hier als PDF zum Download:


