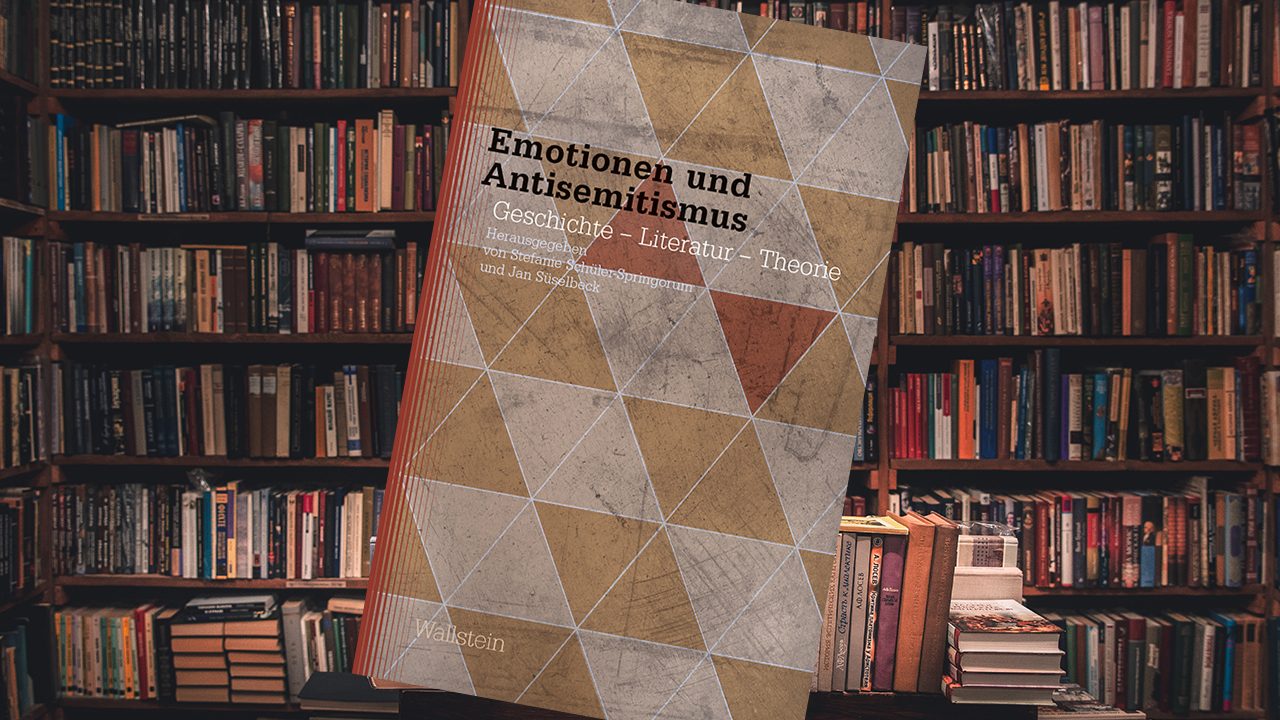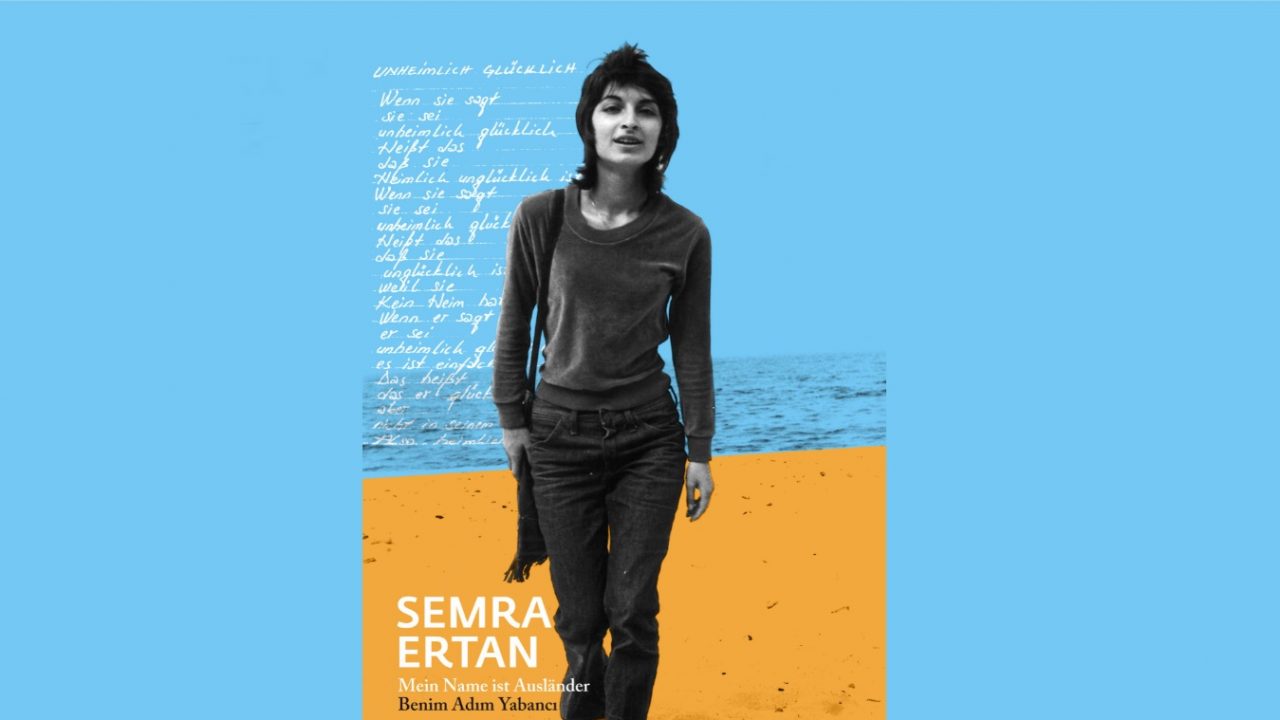Soeben hat der aus Cottbus gebürtige Historiker Stefan Litt, seit 2011 Mitarbeiter der National Library of Israel, den Band Stefan Zweig: Briefe zum Judentum vorgelegt. Er enthält 120 Briefe Zweigs aus den Jahren 1900 bis 1941, in denen Zweigs überdauerndes Interesse für jüdische Themen sowie seine „inneren Zwiespälte“ (Litt) (S. 21) zum Ausdruck kommen.
Freundschaft mit Buber und Herzl
Zweig pflegte u.a. Kontakte zu Martin Buber und Theodor Herzl, er publizierte gelegentlich in der zionistischen Wochenzeitschrift Die Welt. In den neun im Band veröffentlichten Briefen an Buber reflektiert Zweig seine Beziehung zum Judentum, schlägt diesem im Mai 1916 vor, für dessen Zeitschrift Der Jude (1916-1928) von deutschen Autoren jüdischen Ursprungs ein „Bekenntnis“ (S. 46) einzufordern. Dies dürfte „ein ungeheures Document für spätere Zeiten“ (S. 46) sein. Und auf sich selbst bezogen konstatiert er: „Es belastet das Judesein mich nicht, es begeistert mich nicht, es quält nicht nicht und sondert mich nicht.“
Zu einer engeren Zusammenarbeit mit Buber kommt es nicht, weil er, so schreibt Zweig Buber, „die Diaspora liebe und bejahe“. Dennoch versichert er ihm am 21.1.1917: „Nie habe ich mich durch das Judentum in mir so frei gefühlt als jetzt in der Zeit des nationalen Irrwahns.“ (S. 49) Das Eins sein „ohne Sprache, ohne Bindung, ohne Heimat“ (49) sei für ihn ein Idealzustand. Er glaube nicht an die Volksgemeinschaft, an den „Aufbau einer alten Nation“ (S. 53), schreibt er Buber vier Monate später.
Als Zweig die Gefahr durch den Antisemitismus erkennt, regt er Kollegen mehrfach an – so erstmals 1918 –, gemeinsam internationale Aufrufe an die Juden in Österreich und Deutschland zu verfassen; vergeblich. Mehrfach formuliert er sein Ideal einer radikalen Unabhängigkeit. Ihr Schicksal als Juden bleibe es „heimatlos im höchsten Sinne“ zu sein (S. 101), schreibt er 1920. Die Gefährdung durch die Deutschen benennt er in seinen Briefen immer wieder. 1920 warnt er Jean-Richard Bloch, in Erinnerung an Liebknecht und Landauer, vor der „Fehleinschätzung des deutschen Volkes“ (S. 104): „In Deutschland“ sei „der Haß, der sich gegen die Feinde richtete, nicht verschwunden.“ Selbstzerfleischung sei ein „jahrhundertealter Teil unseres Schicksals.“ (S. 107) Ende 1921 versichert Zweig Martin Buber seinen Wunsch nach einem gemeinsamen Gespräch; dies sei ihm ein „dringliches Bedürfnis“ (S. 113). Er warnt ihn nachdrücklich vor der „Undankbarkeit deutscher Politiker“ (S. 113), vor dem Hass, dem für Juden etwas Schicksalhaftes anhafte.
Mehrfach äußert Stefan Zweig seinen Wunsch einer Reise nach Palästina, 1932 auch die Idee einer kombinierten Reise nach Palästina und Ägypten – verwirft dies jedoch immer wieder, wenn es konkret wird. Seiner eigenen Ambivalenz ist er sich hierbei bewusst. 1922 schreibt er dem 24 Jahre jüngeren Hans Rosenkranz, als dieser sein biografisches Interesse gegenüber Zweig brieflich äußert, in erstaunlich persönlicher Weise über seine eigene jüdische Identitätssuche: „Freilich: Sie wollen nach Palästina! Ich fühle das Schöne, das Aufopfernde dieses Entschlusses.“ (S. 199) Jedoch, „etwas hemmt mich, Ihnen da zuzusprechen“ (ebd.) Und 1930 berichtet er seinem Kollegen Hermann Struck – dieser war 1923 nach Haifa übergesiedelt – aus Salzburg von seinem „gewissen Misstrauen“ gegenüber der „zionistischen Bewegung“ (S. 129), welches er nicht abzustreifen vermöge. Verstärkt wurde dies durch das Verbleiben der geistigen Führer in Europa. Die „wahrhaften Bekenner“ (S. 129) hätten vorangehen müssen, dann wäre der Aufbau Palästinas wohl schneller vorangeschritten. Das eigene Beispiel sei „wirksamer als tausend Worte und Reden“ (S. 129). Struck sei der einzige, der persönliche Opfer gebracht, es „entschlossen getan“ habe, deshalb seien ihm dessen Briefe „besonders wichtig und lieb.“ (S. 130)
Flucht nach England
1932 schreibt Stefan Zweig an seinen Vetter Egon: „Meine Reise nach Jerusalem stand für dieses Jahr fest“ (S. 117). Der Wunsch nach Palästina zu reisen war stark, wurde jedoch nie in die Tat umgesetzt.
1934, nach der Niederschlagung des Februaraufstandes in Wien, flieht er nach England, seine Bücher können nicht mehr beim Inselverlag in Deutschland gedruckt werden. Zweig unternimmt regelmäßig Weltreisen, auch nach Lateinamerika und Moskau, hat auch dort ein dankbares Lesepublikum. Ab 1933 verfasst er auch zumindest 15 politische Essays; ein Politiker im engeren Sinne wird der Intellektuelle und Sprachmeister jedoch nie. Die Gefahren durch die Nationalsozialisten benennt er in den Briefen in deutlicher Weise.
1933, kurz vor seiner Übersiedlung nach England, schenkt Zweig, unter dem „Siegel strikter Geheimhaltung“ (S. 144), einen Teil seines Privatarchivs sowie seiner Korrespondenz der Jerusalemer Jüdischen Universitäts- und Nationalbibliothek. Sechs Jahre später, 1939, beschleichen ihn angesichts der „Unsicherheit“ in der „wir leben“, Bedenken an dieser Schenkung nach Jerusalem: Er fürchtet, dass die Jerusalemer Universität „eines Tages ‚arabisiert‘ wird.“ (S. 144)
Mangelnde Solidarität
Immer verzweifelter beklagt er die mangelnde Solidarität der nicht-jüdischen Kollegen – mit Ausnahme von Thomas und Heinrich Mann –, attackiert privatim deren „Feigheit“. Im März 1933 hat Zweig alle Hoffnung verloren, spürt seine Gefährdung als Jude. Am 2.3.1933 schreibt er Romain Rolland: „Keine Hoffnung – das Spiel ist verloren, auf zehn Jahre hinaus, durch Schuld der Sozialisten in Deutschland, durch die Schuld Moskaus, das die Vereinigung der Arbeiter bekämpft hat.“ (S. 147) Der Hitler-Stalin-Pakt sollte ihn wenige Jahre später erschüttern. Moskau war ihm lange als ein möglicher Zufluchtsort für Juden erschienen.
Zwei Wochen später berichtet er seinem neuen amerikanischen Verleger Ben Huebsch von einer „Atmosphäre von Hass und Brutalität ohnegleichen“ (S. 149). Und immer wieder der Wunsch nach einer internationalen Resolution aller „deutschen Schriftsteller jüdischen Stammes“, die man nun „mit dem Rasiermesser absondert“ (S. 157). Am 5.5.1933 bittet er Max Brod um die Zusendung einiger Originalfotografien der Bücherverbrennung, die er für ausländische Zeitungen gut gebrauchen könne. Dann wieder die Beteuerung, „solange es irgend möglich ist“ (S. 163), in Salzburg zu bleiben, weil er das „Emigrieren innerlich für eine Gefahr halte“. Fünf Wochen später beteuert er Romain Rolland: „Die Lage in Deutschland ist schrecklich“ (S. 165). Er sei sich „nahezu sicher“, Salzburg im Herbst zu verlassen. „Es ist unmöglich, in einem Umfeld von Hass zu leben, zwei Schritt von der deutschen Grenze.“ (S. 166) Die ganze Welt könne bald „in Flammen stehen“, die einzige Möglichkeit für ihn selbst sei, den „Wahnsinn zu bezwingen, indem man ihn beschreibt.“ (S. 167) Im November 1933 schreibt er an Rudolf Kayser: „Was ein Jude heute tut, ist immer falsch.“ (S. 177)
„Die Uneinigkeit innerhalb des Judentums“
Er beharrt auf seinem bürgerlichen Standpunkt als Autor: Die „Hitlerei“ könne man nicht wirksamer bekämpfen „als indem wir gute Bücher schreiben und dadurch das Unrecht, das uns angetan wird, vor der Welt offenbar machen.“ (S. 179) Dies schreibt Zweig einen Monat später an den jiddischen Schriftsteller Schalom Asch. Das „Gefährliche der deutschen Sache“ sei eigentlich nicht das „Judenproblem“ an sich, sondern „die Selbstverherrlichung eines Volkes, die zu Hochmut, Aggression und erwiesenermaßen immer zu Krieg“ führe (S. 184).
Von England aus empfindet Zweig die Situation in Österreich und Deutschland als immer gefährlicher. Im Mai 1935 beschreibt er Joseph Leftwich gegenüber seine frühere Heimat Wien als eine „grauenhafte Mischung“ (S.195); und auch in Deutschland sei die Lage seit einem halben Jahr „grauenhaft“ (S. 196) geworden. Dies verknüpft der areligiöse Pazifist mit einem verzweifelten Seitenhieb: Gott habe offenkundig „die Gleichgültigkeit gerne“ (S. 196). Immer wieder beklagt er die „Uneinigkeit“ (S. 205) innerhalb des Judentums; er glaube inzwischen, dass „der Hammer“ wohl „noch härter auf uns fallen“ müsse, schreibt er Max Brod im August 1935.
Die vereinzelten brieflichen Kontakte, die er nach Palästina hat, sind für ihn eine innere Ermutigung angesichts der politischen Entwicklung: „Alles arbeitet für Deutschland und niemand für den Frieden“ (S. 214), schreibt er im Frühjahr 1936 an Schalom Asch. Deshalb freue er sich um so mehr, dass Asch „von Palästina“ einen „starken Eindruck“ habe.
Die „Komplexheit des jüdischen Problems von heute“
Im April 1936 lebt Zweig in London, seine Bedrohungsgefühle werden immer größer. Dem in den USA lebenden Freund und Verleger Ben Huebsch schreibt er, er sehe „besonders schwarz für Österreich“; der „Triumph Hitlers“ werde „immer entschiedener“ (S. 216); inzwischen habe man seine letzten Bücher verboten. Die „Selbstherrlichkeit und Brutalität“ der Leute nehme immer weiter zu. Vielleicht solle er doch bald „nach Amerika hinüberflüchten.“ (S. 217)
Gegenüber Leftwich beklagt er im gleichen Monat die „ganze Komplexheit des jüdischen Problems von heute“ (S. 219). Mit den „radikal-zionistischen Kreisen“ (S. 220) vermöge er sich nicht zu identifizieren, welche einzig die „Kolonisation und nationale Rückgewinnung Palästinas fordern“ (S. 220). Die vereinzelten Einladungen zu internationalen PEN-Kongressen halten ihn innerlich aufrecht.
Mit seinem seit 1932 in Palästina lebenden Namensvetter Arnold Zweig pflegt er einen engen Briefkontakt, wie auch mit Max Brod. Als er im Mai 1936 vom arabischen Aufstand in Palästina, den Angriffen von Arabern gegenüber Juden hört, ist er bestürzt, verzweifelt: Es sei „so wahnwitzig schwer, diese Zeiten zu bestehen.“ (S. 226) Die Nachrichten aus Palästina hätten ihn „für Tage dumpf gemacht“, Palästina habe ihm bisher geholfen, den „Idealismus in der jüdischen Jugend aufzurichten.“ Selbst dies zerbreche nun wegen des „stupiden Nationalismus“. Stefan Zweigs Vereinzelung und Verzweiflung steigern sich von Monat zu Monat. Im Juli 1936 ein Aufschrei gegenüber Leftwich: „Welch furchtbare Zeit! Nach Palästina nun Oesterreich in Hitlers Schatten. Halten wir die Herzen zusammen!“ (S. 230)
Dennoch vermag er weiter zu schreiben, weitere Bücher erscheinen. Als ihn der 1915 in Deutschland geborene und in den USA lebende angehende Rabbiner Alfred Wolf im Februar 1937 anschreibt, weil er Biografisches über Stefan Zweig und dessen Stellung zum Judentum verfassen möchte, ist Zweig erkennbar gerührt und reflektiert seine „persönliche Stellung zum Judentum“ (S. 237). Er erwähnt seine Kontakte zu Buber und Herzl, ein Beziehungsangebot, das er als Verpflichtung und Ermutigung erinnert, wenn ihm auch „jeder Fanatismus“ fehle und „jede Einseitigkeit und Einlinigkeit“ (S. 237). Deshalb sei ihm Zionismus und Palästina nie als „die“ Lösung erschienen. Er möchte immer noch nicht, dass das „Judentum aus seiner Universalität und Uebernationalität sich ganz ins Hebräische und Nationale einkrustet.“ Es habe immer die zwei konträren Richtungen innerhalb des Judentums gegeben. Er lehne immer noch eine „gewaltsame Absonderung des Judentums“ ab und halte diese „für eine grosse moralische Gefahr.“ Er habe, „nie meine Gesinnung verleugnend“, sein literarisches Werk nie als „nur jüdisch“ verstanden: „Da wir eben Juden sind, und es nicht verleugnen, so wird in sich schon dieses Werk einen jüdischen Charakter annehmen.“ (S. 238)
1936 schließt Zweig sein Werk „Der begrabene Leuchter“ ab, welches er als eines seiner genuin jüdischen Werke komponiert hat.
Nicht zum Bittsteller werden
Stefan Zweig suchte verzweifelt Möglichkeiten der Emigration. Er ist verzweifelt über die Situation der Juden in Wien, denkt an seine 84-jährige Mutter, der er nicht zu helfen vermag – sie sollte zwei Monate später sterben –, fühlt sich „unsäglich müde“; vor allem möchte er nicht, in seinem 57. Lebensjahr, „zum Bittsteller“ werden (S. 259).
Stefan Zweig vermag zu Lesereisen nach Südamerika aufzubrechen. In einem Brief vom März 1938 an Schalom Asch, ein Jahr vor dem Hitler-Stalin-Pakt, erwägt er einen „Appell an Russland“ (S. 256), damit dieses wenigstens jüdische Ingenieure oder Techniker aufnehme, auch als eigennütziger Schutz gegen den „vorbereiteten deutschen Krieg“. Und doch weiß er: „Aber dort herrscht ja Spionagewahnsinn – die ganze Welt ist irrsinnig.“ (S. 256)
Am 23.12.1939 schildert er seinem langjährigen befreundeten Kollegen Joseph Leftwich seine Isolation: In London habe er sich „vollkommen unnütz“ gefühlt. (S. 274) Er sei tief besorgt wegen der nationalsozialistischen Verfolgungsmaßnahmen in Polen: „Geschieht eigentlich genug in America für die Sache der Juden in Polen?“ (S. 275) In England sei „das Interesse zu sehr von der eigenen Sache absorbiert.“
Endstation Brasilien
1936 ist er erstmals auf Vortragsreise in Brasilien, 1940 gelingt die Emigration mit seiner neuen Ehefrau. Anfangs lebt er in Rio de Janeiro. Sicher fühlt er sich wegen der nationalsozialistischen Expansion auch dort nicht. „Jede Woche steigt die Gefahr“ schreibt er im September 1940 an Abraham Shalom Yahuda. Immerhin habe er in Rio „auch für die jüdischen Kreise“ sprechen können. Die Zersplitterung der Juden in unterschiedliche politische Gruppierungen erlebt er auch in Brasilien. Er habe auch unter den Juden in seinen neun Zufluchtsorten einen „schweren Stand“: „Von rechts und links“ (S. 278) wollten sie einen Vortrag von ihm haben. „Ich sehe leider, dass sie in Gruppen zerspalten sind.“ 1941 schließt er nach drei Jahren, von schweren Depressionen gequält, sein literarisches Meisterwerk Die Schachnovelle ab. Zeitgleich stattet er seinem Zufluchtsland mit dem Werk Brasilien – ein Land der Hoffnung einen symbolischen Dank ab.
„Aus freien Stücken…“
Die Temperatur in Rio de Janeiro erträgt der durch die Flucht schwer Traumatisierte nicht gut, die soziale Isolation setzt ihm schwer zu. Brasilien ist ein „Land der Hoffnung“, aber für den 60-jährigen Exilanten mit seinen Depressionen kommt die Hoffnung zu spät. Im September 1941 übersiedelt er in das auf den Bergen gelegene Petrópolis, ein halbes Jahr Leben bleibt ihm noch. Der letzte der 120 Briefe, vom Herbst 1941, ist an den aus Buchenwald entkommenen und soeben nach Brasilien geflohenen Rabbiner Henrique Lemle gerichtet – und enthält noch einmal eine jüdische Selbstbestimmung. Die Einladung, in der Reformsynagoge in Rio de Janeiro anlässlich eines jüdischen Ehrenamtes eine Ansprache zu halten, müsse er ablehnen. Er sei „sehr lax in Dingen des Glaubens erzogen“ worden (S. 279) und vermöge „ein Unsicherheitsgefühl in einer wahrhaft gläubigen Versammlung“ nicht zu „bemeistern“. Diese Ehrung solle man lieber „jemandem zuteilen, der ihrer innerlich würdiger ist.“ (S. 280)
Vier Monate später, in der Nacht zum 23. Februar 1942, nimmt sich der 61-jährige Exilant Stefan Zweig im Paradies Petrópolis mit einer Überdosis Veronal das Leben, seine Ehefrau Lotte folgt ihm in den Tod. Er hinterlässt einen Abschiedsbrief, in dem er beteuert, er scheide „aus freiem Willen und mit klaren Sinnen“ aus dem Leben. Die Zerstörung seiner „geistigen Heimat Europa“ habe ihn entwurzelt, seine Kräfte seien „durch die langen Jahre heimatlosen Wanderns erschöpft“.
Stefan Zweig: Briefe zum Judentum. Herausgegeben von Stefan Litt. Suhrkamp Verlag / Jüdischer Verlag 2020, 295 S., 24 Euro, Bestellen?
Foto: Wikimedia / Clemensfranz / CC BY-SA 4.0