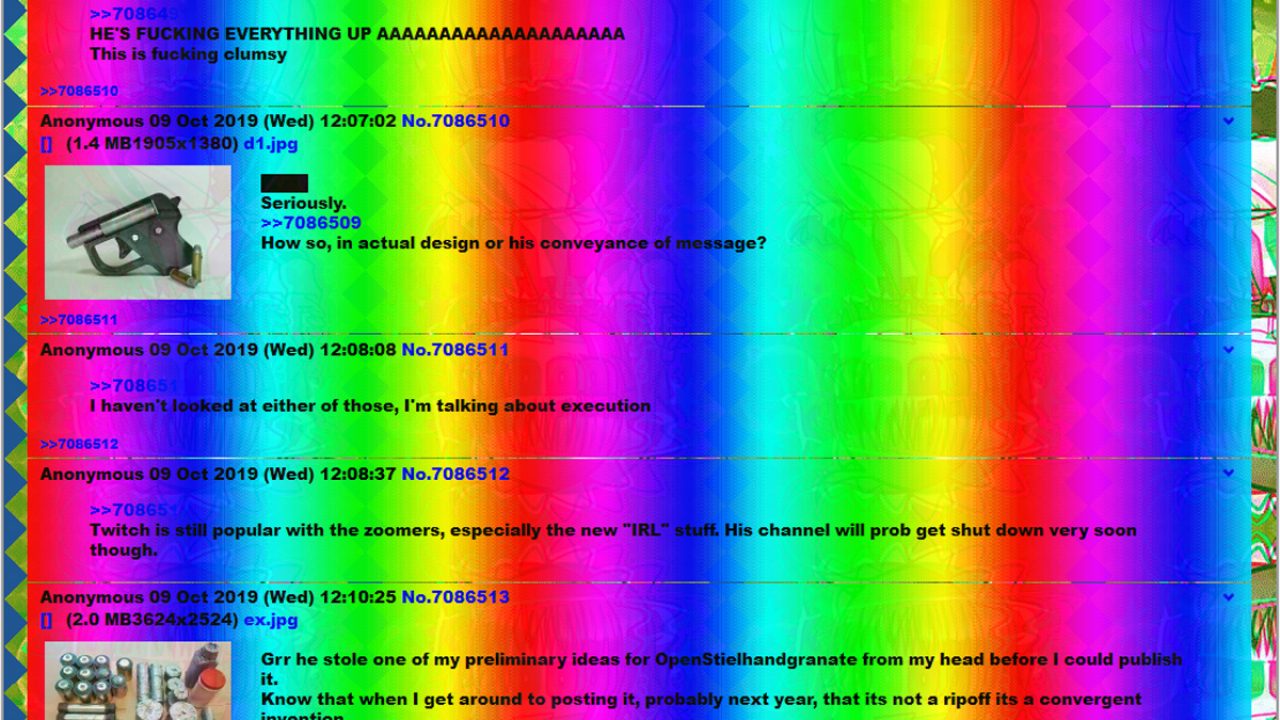Wie drängend manche Problemlagen sind, zeigt sich auch an der Beteiligung an Tagungen. Der große Saal im ersten Stock des Roten Rathauses in Berlin ist mit rund 150 Teilnehmer*innen aus Zivilgesellschaft, Polizei, Justiz und Wissenschaft voll gefüllt, als der Berliner Justizsenator Dirk Behrendt die Tagung „Hassgewalt begegnen – Betroffene stärken“ der Amadeu Antonio Stiftung am 13.02.2020 eröffnet. Einen Dialog zu ermöglichen zwischen den Anwesenden ist das Ziel der Tagung, Panel zu verschiedenen Aspekten bieten die Chance dazu. Denn nur gemeinsam kann der bessere Umgang mit Hasskriminalität gelingen, findet Justizsenator Behrendt: „Zivilgesellschaftlicher Zusammenhalt ist unverzichtbar im Kampf gegen Hassgewalt – aber Staat, Polizei und Gerichte braucht es auch, die sagen: wir stehen an Eurer Seite, der Seite der Betroffenen!“ Als Aufgabe formuliert er dabei auch demokratiefeindliche Bestrebungen innerhalb der Polizei: “Bei rechtsextremen Verdachtsfällen muss der Staat deutlich handeln – es darf keinen Rechtsextremismus unter dem Deckmantel von Polizei und Justiz geben.“
Was tun? Unklare Zuständigkeiten, Ermittlungspannen, Cop-Culture bearbeiten
Timo Reinfrank, Geschäftsführer der Amadeu Antonio Stiftung, führte mit Beispielen in die Thematik der Tagung ein: „Betroffene von Hassgewalt werden etwa entmutigt, wenn Verfahren eingestellt werden, angeblich aus ‚mangelndem öffentlichen Interesse‘. Das ist eine zusätzliche Abwertung.” Aber auch in der Polizei sieht er bearbeitenswerte Zustände: „Wenn es Rechtsextremismus in der Polizei gibt, unklare Zuständigkeiten, Ermittlungspannen, Cop-Culture, schwindet das Vertrauen in die Polizei – diese Probleme müssen wir bearbeiten, wenn wir wollen, das alle Menschen in Deutschland gleichermaßen an der Rechtsstaat glauben können.“
Was tun? Verfahren zu Hasskriminalität nicht mehr einstellen, Polizist*innen auf Demokratiefeindlichkeit prüfen
Ein flammendes Plädoyer über Problematiken und Veränderungswünsche hielt im Anschluss der Rechtsanwalt Mehmet Daimagüler, der viele Opfer rassistischer Gewalt oder ihre Hinterbliebenen vertritt, u.a. sieben Mandanten als Nebenkläger im NSU-Prozess. Im NSU-Prozess durften noch alle Hinterbliebenen der Anschläge Nebenklage-Anwälte haben – inzwischen gab es eine Gesetzesänderung, die es Richter*innen ermöglicht, bei solchen Verfahren eine Gruppenbetreuung durch einen Anwalt für alle Nebenkläger zu bestimmen. Daimagüler sagt: “Das Argument ist: Alle Nebenkläger hätten die gleiche Interessen. Haben sie aber nicht. Manche wollen Aufklärung, andere wollen verstehen, andere wollen vor allem eine harte Bestrafung.“ Als positiv wird in der Gesellschaft diskutiert, dass es inzwischen einen Fonds für Entschädigungszahlungen für Opfer von Hassgewalt gibt. Doch Daimagüler berichtet, dass dort viele Fälle von rassistisch oder homofeindlich motivierter Hassgewalt nicht als solche anerkannt werden: “Und die Beweislast liegt beim Opfer. Ein Opfer, dass sich einen Anwalt leisten kann, bekommt hier Gerechtigkeit. Ein Opfer, dass sich keinen Anwalt leisten kann, nicht. So sollte es nicht laufen.”
Jede Erfahrung von Diskriminierung, aber vor allem von Hassgewalt beschränke die Betroffenen in ihrem Leben: „Das versetzt in Angst und Schrecken, weil die Betroffenen damit rechnen müssen, jederzeit angegriffen zu werden. Das verändert das Verhalten und das Sicherheitsempfinden der Betroffenen fundamental.“ Die Taten der Hassgewalt – nicht gegen einzelne Menschen, sondern gegen Menschen aufgrund einer zugeschriebenen Gruppenzugehörigkeit – wirken aber nicht nur auf die betroffenen Person, sondern auch auf die angegriffene Gruppe, und gehen deshalb die gesamte Gesellschaft an, sagt Daimagüler. Wenn solche Verfahren eingestellt werden, wegen Geringfügigkeit oder vorgeblich “mangelndem öffentlichen Interesse”, ist dies nicht nur frustrierend für die Opfer, sondern widerspreche geltender Gesetzgebung: “Ich bin dafür, dass diese Verfahren nicht mehr eingestellt werden dürfen – oder dass der Staatsanwalt zumindest begründen muss, warum er ein Verfahren einstellen will.” Für die Polizei wünscht er sich bessere Prüfungen bei der Einstellung, damit nicht Demokratiefeinde in Ämter kommen, in denen sie über andere Macht ausüben oder Recht sprechen, und eine Suspendierung schon beim Anfangsverdacht, wenn sich Polizist*innen, Richter*innen oder Staatsanwälte im Amt demokratiefeindlich betätigen. Außerdem müsse wissenschaftlich erhoben werden, wie groß das Problem des institutionellen Rassismus in der Polizei ist – damit es bearbeitet werden kann.
„Meine Lehre aus dem NSU: Wir müssen aufhören zu schweigen, wenn Diskriminierung passiert. Schweigen ist Mittäterschaft.“
Eröffnungspodium: Einzelfälle oder strukturelles Problem? Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und rechtsradikale Ideologien in Polizei und Justiz
Wo liegen die Probleme bei der Polizei? Für die Gäste des Eröffnungspodiums waren das vor allem Abwertung und Diskriminierung im Polizeialltag. So merkte Wissenschaftlerin Doris Liebscher von der Humbold-Universität in Berlin an: „Es geht nicht nur um manifeste rechte Ideologie, sondern um die Routinen, die auch auf Vorurteilen basieren und als normal wahrgenommenen werden. Dazu gibt es kaum Forschung.“ Fehlende Forschung sieht auch Götz Frommholz von der Open Society Foundation: „Wir brauchen mehr gute Studien! Wie kommt es zu Racial Profiling? Wie wird ermittelt, was begünstigt das? Was passiert mit jungen Beamt*innen im Dienst, dass sie Menschenrechte im Alltag vergessen?“
Was tun? An rassistischen Strukturen arbeiten
Diese Erfahrung macht auch Professor Rafael Behr von der Akademie der Polizei in Hamburg. Seine Studierenden hätten zum Anfang des Studiums in den seltensten Fälle rechte Einstellungen, aber einige entwickelten sie im Laufe ihres Arbeitslebens – auch, weil keiner dem Einhalt gebietet. Zum Umgang findet Behr: „Es geht mir nicht nur um Zahl X – die der Rechtsextremen in der Polizei, sondern um Zahl Y – damit meine ich die, die sich nicht trauen einzugreifen, wenn Zahl X jetzt anfängt, immer lautere und frechere Sprüche zu machen.“ Er beobachtet, dass das Klima in der Polizei aktuell autoritärer werde, die Polizist*innen auch weniger kritikfähig werden. Judith Porath, Sprecherin des Verbandes der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt e.V., kommentiert aus der Perspektive der Betroffenen: „Warum rufe ich die Polizei? Sie soll mir Schutz gewähren! Wenn ich den nicht bekomme, verliere ich das Vertrauen in das ganze System. Dass lässt sich nur auffangen, wenn es Konsequenzen für Beamte gibt, die diskriminieren – aber die fehlen viel zu oft.“ SPD-Politikerin Eva Högl, die u.a. im NSU-Untersuchungsausschuss im Bundestag saß, bringt es auf den Punkt: „Es geht um Strukturen, Routinen, Mustern – es sind keine Einzelfälle! Das verharmlost, verkleinert das Problem. Es geht um institutionellen Rassismus. Nicht um einige rassistische Beamte, sondern um rassistische Strukturen. Daran müssen wir arbeiten.“
Panel 1 – Ermittlungsarbeit der Polizei: Von der Anzeige zur Statistik – Hassgewalt als Sachbeschädigung?
Im ersten Panel des Kongresses wurde die kriminalistische Erfassung und Kategorisierung von Hassverbrechen diskutiert. Aus Sicht der vertretenen zivilgesellschaftlichen Organisationen werden zu oft Fälle, in denen offensichtlich Hass der Beweggrund für ein Gewaltverbrechen ist, von Polizeibeamt*innen und der Justiz mit unzureichender Konsequenz verfolgt und als Verbrechen ohne politischen Hintergrund eingeordnet. Eins der Beispiele war ein mutmaßlicher Brandanschlag auf eine Geflüchtetenunterkunft, der vom Täter kurz zuvor unter Äußerung rassistischer Aussagen angekündigt worden war. Im Gerichtsverfahren wurde jedoch keine politische Absicht und Gefährdung von Menschenleben festgestellt. Letzteres habe an der Untauglichkeit des Brandsatzes gelegen. Zudem bemängelte Marius Münstermann von der Amadeu Antonio Stiftung, dass die Informationen einiger LKAs über Vorfälle z.B. rassistischer Gewalttaten Journalist*innen erst durch parlamentarische Anfragen zur Verfügung gestellt würden. Eine einheitliche Informationspolitik sei hier nicht festzustellen.
Ein weiterer Fokus der Diskussion lag auf der mangelnden Unterstützung Betroffener von Hassgewalt. Ein Grund für mangelnde Unterstützung sei auch mangelndes Verständnis für marginalisierte Perspektiven. Ein*e Polizeibeamte*r verstehe nur selten die Situation einer permanenten Bedrohungslage aufgrund von Hautfarbe oder Sexualität und agiere daher oftmals ohne die nötige Sensibilität. Nicht nur das – Kati Becker (Register zur Erfassung rechtsextremer und diskriminierender Vorfälle in Berlin) beklagt regelmäßige Täter-Opfer-Umkehr bei Vernehmungen Betroffener durch die Polizei à la „Wieso hielten Sie sich dort auf?“. Die Wissensvermittlung über die Situation und Perspektive der Opfer von Hasskriminalität solle daher in der polizeilichen Ausbildung eine prominentere Stellung erhalten. Außerdem forderte Saideh Saadar-Lendle (Les MigraS e.V.) eine bessere Versorgung der Opfer von Hasskriminalität über den Stand ihrer Verfahren. Diese fühlten sich oftmals alleingelassen, was ihr Sicherheitsgefühl alles andere als verstärke.
Der Vertreter der Staatsanwaltschaft Berlin, Vincent Hagendorf, wies darauf hin, dass im Fall von Körperverletzung laut Gesetz von einem berechtigten öffentlichen Interesse ausgegangen werden könne. Dies solle konsequenter beachtet werden, um Journalist*innen und Betroffenen den Zugang zu Informationen zu erleichtern. Gesetzesänderungen, die die Kategorisierung und Behandlung von Hassgewalt und den Umgang mit ihren Opfern verändern könnten, halte er jedoch nicht für nötig.
Ähnlich klang die Argumentation Daniel Hiltmanns vom LKA Berlin, welcher sich für intensivere Reflexion innerhalb der Polizei aussprach, um den Umgang vor allem mit den Opfern von Hassgewalt in Vernehmungen zu verbessern. Darüber hinaus sei das Disziplinarrecht gegebenenfalls anzuwenden. Gesetzliche oder strukturelle Änderungen schlug auch er nicht vor.
Panel 2 – Gerichtliche Bearbeitung von Hasskriminalität: Wiederherstellung von Gerechtigkeit oder sekundäre Viktimisierung?
Das Panel zur gerichtlichen Bearbeitung von Hasskriminalität startet mit der ernüchternden Feststellung von Rechtsanwältin Kati Lang, das es keinerlei Dokumentation oder Forschung dazu gibt, ob es in Staatsanwaltschaften und Gerichten nach der Aufdeckung de NSU eine Veränderung in der Rechtsprechung gegeben hat. Lang sagt: “Bei der Polizei wissen wir von Lehren aus dem NSU – im Gericht können wir nur raten.” Urteile zu Hasskriminalität haben aber immer eine politische Symbolfunktion – für die Täter*innen, die Betroffenen und die Gesellschaft. Kati Lang bringt es auf den Punkt: „Hassgewalttaten sind Botschaftstaten, die treffen nicht nur die Betroffenen, sondern senden Signale in die Gesellschaft. Deshalb sollten wir sie nicht als Angriffe auf Minderheiten behandeln, sondern als Angriffe auf den Staat. Der Schutz der Betroffenen ist Staatsschutz. “
Dies ist ein Wunsch und erstrebenswerter Anspruch, doch in der Realität erleben Opfer von Hasskriminalität oft eine Negierung ihrer Erfahrungen, werden nicht gehört und ernst genommen. Rechtsanwalt Onur Özata beschreibt die Folgen: „Ermittlungen können sehr schädigend sein, wenn sie vorurteilsgeleitet passieren. Wenn rassistische Gewalttaten vor Gericht entpolitisiert werden, ist das ein Schlag ins Gesicht für die Angehörigen. Das ist sekundäre Viktimisierung.“
Die anwesenden Richter*innen erklären sich: Wenn in den Ermittlungsakten nichts zu Rassismus oder Antisemitismus im Tatzusammenhang stände, könnten sie ja nur auf diese zurückgreifen. Eine Richterin im Publikum sagt: „Wir Richter können nur aburteilen. Was vorher schiefgelaufen ist, können wir nicht gerade rücken.“ Hasskriminalität sei ja kein Straftatbestand, es sind verschiedene Straftatbestände. Deshalb könne man keine Statistik dazu führen.
Ihnen wird entgegengehalten, dass es vielleicht vor allem mangelndes Wissen über Antisemitismus und Rassismus ist, dass sie diese Tatmotivation übersehen lässt. Eine Wissenschaftlerin aus dem Publikum fragt: „Brauchen Sie nicht Fortbildungen? Sie haben ja im Studium gar nicht gelernt, was Rassismus oder Antisemitismus ist?“ Solche Fortbildungen gäbe es ja, ist die Antwort, aber nur auf freiwilliger Basis, denn die Justiz sei eben unabhängig. Es sei auch nicht so, dass alle Richter*innen davon keine Ahnung hätten, man müsse das individuell sehen.
Einer jungen Juristin aus dem Publikum reicht das nicht:
„Reden wir nicht um den heißen Brei herum: wie sollen Richter Rassismus erkennen, wenn sie nicht wissen, was Rassismus ist? Im Jurastudium hab ich das nicht gelernt. Es muss doch darum gehen: Wie lösen wir das jetzt?“
Denn Richter*innen können durchaus etwas tun, wenn sie ein diskriminierendes Motiv vermuten. Rechtsanwalt Onur Özata erläutert: “Sie haben Ermittlungsbefugnisse. Sie haben ein Ermessen. Sie können Rassismus benennen. Sie können Nebenklage-Beweisaufnahmen zulassen.” Eine weitere Ideen wäre die Spezialisierung von Gerichten und ihren Staatsanwält*innen und Richter*innen aus Hasskriminalität für sensiblere und kenntnisreichere Rechtssprechung. Denn was passiert, wenn die fehlt, beschreibt Benjamin Steinitz von RIAS – Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus: „Nur jede fünfte antisemitische Straftat wird überhaupt angezeigt, weil die Betroffenen denken, das führe eh zu nichts. Weil sie es so erleben. Das Vertrauen in den Rechtsstaat ist massiv gestört unter Jüdinnen und Juden. Wenn Gerichte ein Graffiti wie ‚Juden Jena‘ nicht als antisemitisch erkennen und von ’szenetypischer Fußballsprache‘ sprechen, zeigen Betroffene nicht mehr an – und der Fußballverein wehrt sich gegen den Antisemitismus der Fans auch nicht mehr.“
Panel 3 – Ausbildung, Weiterbildung, Intervention – Changing Behördenkultur
Die Podiumsdiskussion zum Thema „Changing Behördenkultur“ wurde von Miriam Camara (akoma coaching & consulting) moderiert und mit einem Einführungsstatement ihrerseits begonnen. Darin bemängelte sie das fehlende Verständnis in den Ermittlungsbehörden für verschiedene Formen von Diskriminierung. „Dieses Verständnis geht einher mit der Qualität von Ermittlungsarbeit“, so Camara. Das Fehlen einer Kategorie für rassistische Gewalt sei Ausdruck dessen.
In der anschließenden Diskussion wurde unter anderem die aktuelle Struktur der Jura-Studiengänge an Universitäten in Deutschland thematisiert. Ansätze wie in den USA, wo kritische Perspektiven auf strukturelle Machtverhältnisse in der Justiz integraler Bestandteil der Lehre geworden sind, seien hier nur in absoluten Ausnahmefällen vertreten, kritisierte auch der Direktor der Deutschen Richterakademie, Dr. Stephan Jaggi. Stattdessen spiele die Perspektive marginalisierter Personen in der Vorbereitung auf die Staatsexamina keine Rolle. Auch in der polizeilichen Ausbildung werde zwar die Rolle der Polizei im Nationalsozialismus erklärt, ein Bewusstsein für strukturell bedingte Machtverhältnisse in der heutigen Polizeiarbeit gegenüber Opfern von Hassgewalt würde aber nicht vermittelt.
Des Weiteren wurde die Teilnahme von Richter*innen an Weiterbildungen auf freiwilliger Basis beanstandet. Richter*innen müssten unabhängig vom eigenen Interesse Wissen über Diskriminierung vermittelt bekommen, um mit Fällen von Hasskriminalität angemessen umgehen zu können.
Den bisherigen Umgang mit der Vermittlung von Wissen über Diskriminierung bezeichnete Saraya Gomis (Each One Teach One e.V.) als Symbolpolitik:
„Wie kommen wir weg von Symbolpolitik, wie einmal im Jahr ein Tag zum NS?“
Dies sei Ausdruck einer weitverbreiteten Historisierung von Antisemitismus, so Marina Chernivsky (Kompetenzzentrum Prävention und Empowerment der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e.V.), und verschließe die Augen vor der aktuellen Ausprägung antisemitischer Agitation. Das Beschränken auf die Steigerung von personeller Diversität in Polizei und Justiz könne zudem nicht ausreichen, da auch entsprechende Kompetenzen im Umgang mit marginalisierten Opfern von Hassgewalt nötig seien.
Panel 4: Ansprechpersonen, Beauftragte, Ombudsleute – ein wirkungsvolles Instrument zur Stärkung von Betroffenen?
Bei diesem Panel stand ein Elefant im Raum. Petra Follmer-Otto vom “Deutschen Institut für Menschenrechte” führte in Thema: „Für Betroffene diskriminierender Gewalt braucht es Sensibilisierung in den Behörden, unabhängige Beschwerdestellen, Schutz in der Strafverfolgung und die Anerkennung, dass nicht nur Einzelne von Gewalt betroffen sind, sondern ihre ganze Community.“
Dies sahen auch alle anderen Diskutanten auf dem Podium so: Ansprechpersonen bei Staatsanwaltschaften oder bei der Polizei für LGBTI*, Antisemitismus und “interkulturelle Angelegenheiten”. Alle berichteten von ihrer verdienstvollen und guten Arbeit, von Überzeugungsarbeit und Übersetzungstätigkeiten in den alltäglichen Polizei- oder Justizbetrieb.
So berichtete etwas Staatsanwalt Adrian Voigt, wie schwer es war, Homosexuelle zu überzeugen, Gewalttaten bei der Polizei anzuzeigen, als Homosexualität selbst noch als zu verfolgende Straftat galt: „Am Anfang stand die Frage: wie bringen wir Homosexuelle dazu, der Polizei als Opfer zu vertrauen, wenn sie Polizei nur als Verfolger kennen? Und in der Polizei: wie bringen wir Polizist*innen dazu, homofeindliche Hintergründe zu ermitteln?“ Er berichtet von kleine Ideen mit großer Wirkung: “Wir haben angefangen, Betroffene darüber zu informieren, wie ihre Verfahren ausgehen. Das müssten Staatsanwälte nicht machen, aber sie dürfen es natürlich. Und wir fanden: Die Opfer müssen doch wissen, wie ein Verfahren ausgeht.“
Tayfur Uyulmaz von der Polizei Berlin berichtet: „Als Stelle für interkulturelle Aufgaben sind wir Ansprechpartner für Fragen für die Polizeistrukturen von innen – und für die Anfragen von außen. Ich berate, vermittle und versuche, ein gegenseitiges Kennenlernen zu ermöglichen, wo es Unsicherheiten gibt.“
Und Wolfram Kemp, seit einem halben Jahr Antisemitismusbeauftragter der Polizei Berlin, beschreibt seine Arbeit: „Ich gucke nicht Beamt*innen über die Schulter, ob sie Antisemitismus richtig erfassen. Ich schule sie vorher: Frag nach der Opferperspektive! Wenn das Opfer sagt, es glaubt an eine antisemitische Motivation – schreib es auf und beginne zu ermitteln.” Er findet: „Die Kolleg*innen sollen sich als Beschützer*innen von Minderheiten verstehen! Die Hürde für die Erfassung würde ich so niedrig wie möglich legen. Erst mal als antisemitisch erfassen – wenn es das nicht war, können wir es ja im Laufe der Ermittlungen streichen.“
Das ist alles sehr gut und inspirierend. Der Elefant, der im Raum steht, wird mit der ersten Publikumsfrage benannt:
„Warum gibt es denn keine unabhängigen Rassismusbeauftragten bei der Polizei? Viele von Rassismus Betroffene haben Angst vor Rassisten in der Polizei und in der Staatsanwaltschaft, haben Angst, zu den Behörden zu gehen, und bäruchten doch auch Ansprechpersonen.“
Das Podium fühlt sich mit dieser Frage allerdings überfragt. Schließlich sagt Wolfram Pemp: “Braucht die Polizei einen Rassismus-Beauftragten? Fragen Sie das doch nicht die Polizei! Das ist eine politische Entscheidung. Wenn sie es für sinnvoll halten, fordern Sie es, führen Sie es ein.“
Abschlusspodium: Gefahreneinschätzung, Sicherheitskonzepte, politische Interventionen
Zum Ende des Tages ging es noch einmal konzentriert um die Frage von Konsequenzen von Bedrohungen und Gewalt. Ferat Koçak ist gegen Nazis engagierter Lokalpolitiker in Berlin und wurde Opfer eines Brandanschlags im Zuge der bisher weiter unaufgeklärten rechtsextremen Anschlagsserie mit mindestens 55 Taten in Berlin-Neukölln. Er berichtet von seinen Erfahrungen: „Ich bin in Berlin geboren, gehöre hierher, und wir stritten gerade darüber, ob ‘Migrationsgeschichte’ eine schönerer Ausdruck ist als ‘Migrationshintergrund’.. Da kam Sarrazin mit seinem Buch vorbei, so dass wir uns plötzlich ganz fremd in dieser Gesellschaft fühlten, obwohl wir ja hierher gehören. Und heute sitzt die AfD in den Parlamenten. Das macht mir Angst. Der Anschlag auch. Nach dem Anschlag hatte ich Angst vor jedem. Heute kann ich – dank der Hilfe von Opferberatungsstellen – darüber reden.“ Bei der Polzei hatte Ferat Koçak dagegen eher NSU-Assoziationen: „Die Polizei hat mich als erstes gefragt, ob der Brandanschlag etwas mit meinem Migrationshintergrund zu tun habe. Da war es quasi eine Art trauriges “Glück”, dass in der gleichen Nacht auch Buchhändler Ostermann angegriffen wurde, so konnte ich die rechtsextreme Motivation schnell klarmachen.“
Tom Schreiber von SPD kennt Übergriffe auch selbst und versucht strukturelle Veränderungen zu bewirken: „Angst darf den Alltag nicht bestimmen. Das sagt sich leicht, ist aber schwieriger, wenn man selbst bereits angegriffen wurde. Wir versuchen, Polizei und Staatsanwaltschaften zu stärken, um das Sicherheitsgefühl zu stärken.“
Auch Judith Rahner von der Amadeu Antonio Stiftung kennt Bedrohungen verschiedenster Art: „Die Bedrohungslage hat sich für uns enorm verschärft. Wir müssen eine Risikobewertung inzwischen zur Grundlage allen Handelns machen. Zu den gewalttätigen Bedrohungen kommen Bedrohungen über Anfragen, Delegitimierung, DSGVO. Es wird auch eine größere Breite von Organisationen angegriffen, Gewerkschaften, Vereine, Wohlfahrtsverbände. Schlimmstenfalls hat das zur Folge, dass sich Zivilgesellschaft zurückzieht.“
Das bestätigt Matthias Müller von der MBR Berlin: „Wenn Menschen angegriffen werden, die das nicht erwarten, ist die Erschütterung des Sicherheitsgefühls besonders hoch, mehr als etwa Aktivist*innen, die ein Risiko erwarten. Die Polizei muss auf Bedrohungen empathisch reagieren. Wir hören aber auch von Ungleichbehandlung der Betroffenen bei der Polizei. Es wird unterschiedlich agiert, ob etwa Politiker*innen angegriffen werden oder Antifa-Aktivist*innen. Alle Opfer sollten aber gleich sensibel behandelt werden!“
Was tun?
Nach dieser ersten Idee gab es aus der Praxis noch viele, die benannt wurden: Personen, die auf Feindeslisten stehen, müssen sofort erfahren, welche Informationen Rechtsextreme über sie gesammelt haben, Melderegistersperren sollten ohne Beweislast für Betroffene sein und nicht nur für Kommunalpolitiker*innen, sondern auch für Engagierte aus der Zivilgesellschaft zugänglich; Verfahren zu Hassverbrechen sollten nicht mehr eingestellt werden dürfen; gut wären Ansprechpersonen für alle von Diskriminierung Betroffenen in den Behörden; Betroffenen müssten in den Ermittlungen befragt und besser gehört werden, was ja auch dem Aufklärungsbedürfnis der Polizei helfe; ein Anti-Rassismus-Gesetz für Berlin; mehr Auseinandersetzung mit Alltagsrassismus in der Politik; in der Kriminalitätsbekämpfung die Opferperspektive stärken, auch Opferhilfe stärken; Im öffentlichen Dienst genügend Personal einstellen, um Kompetenz- und Wissenverluste in der Strafverfolgung zu verhindern.
Zu tun gibt es also noch genug, Ideen aber auch.
Mehr zu Opferfonds Cura:
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.