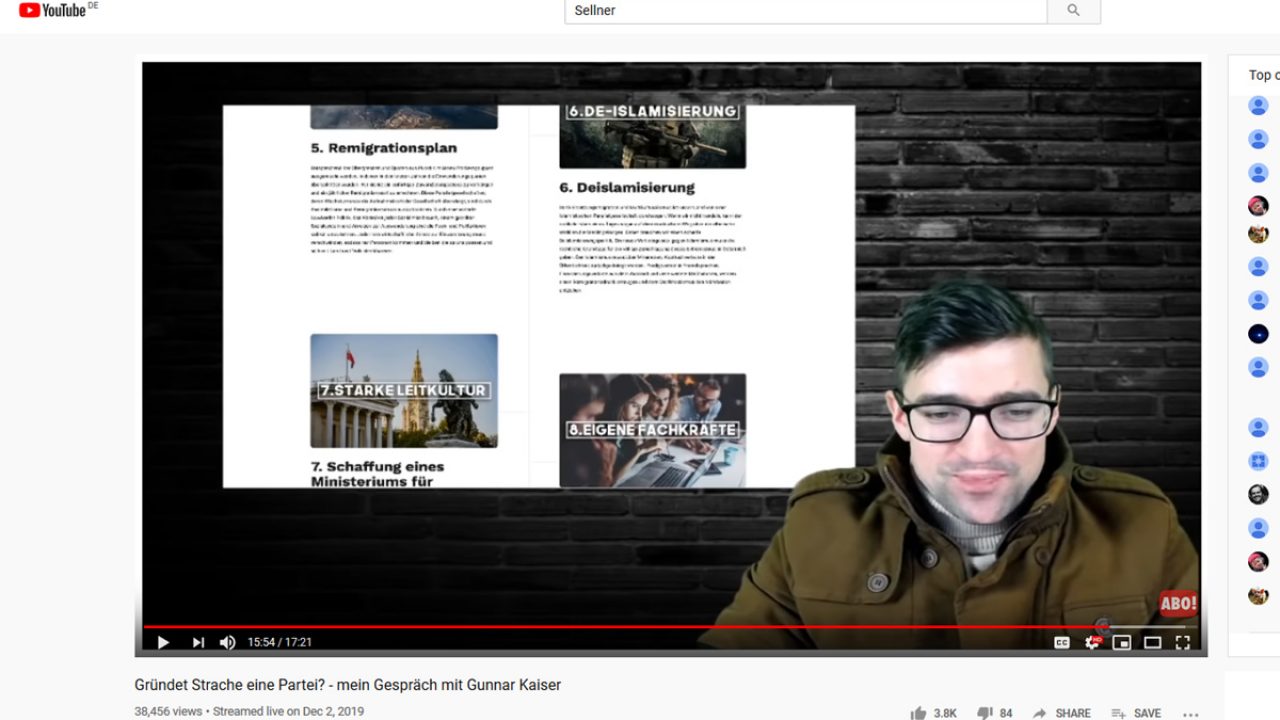Im Gespräch: Kevin Rittberger, geboren 1977 in Stuttgart, ist Theaterautor und Regisseur. Er hat an vielen renommierten deutschen Theatern wie dem Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, dem Schauspielhaus Wien und dem Schauspiel Frankfurt gearbeitet. 2010 wurde ihm der Kurt-Hübner-Regiepreis verliehen, 2011 wurde er für den Mülheimer Dramatikerpreis nominiert.
Herr Rittberger, in Ihrem neuen Theaterstück „Schwarzer Block“ am Berliner Maxim Gorki Theater geht es um antifaschistischen Widerstand der letzten 100 Jahre. Warum wollten Sie das Thema Antifaschismus auf die Bühne bringen?
Kevin Rittberger: Nach den Ereignissen in Kassel, Hanau und Halle ist es immer notwendiger geworden, das Thema auf die Bühne zu bringen. Ich habe mit der Recherche nach dem G20-Gipfel begonnen. Aber schon 2016 habe ich mich in meinem Theaterstück „Peak White“ im Heidelberger Theater mit den sogenannten „Neuen Rechten“ beschäftigt. Mit anderen Theaterschaffenden habe ich damals auch die Plattform „Keine Bühne“ gegründet. Auslöser war die Störung der „Identitären Bewegung“ im Gorki bei einem Gespräch zwischen dem „Freitag“-Verleger Jakob Augstein und der evangelischen Theologin Margot Käßmann über das Tragen der Burka.
Dieser Vorfall im Gorki ist kein Einzelfall: Ähnliches passierte 2015 bei Falk Richters Stück „Fear“ in der Berliner Schaubühne oder 2018 bei Turbo Pascals „Gala Global“ im Deutschen Theater. Welche künstlerischen Strategien gibt es gegen solche Störaktionen aus dem neurechten Spektrum?
Nach dieser Aktion im Gorki habe ich mit Theaterschaffenden genau darüber gesprochen. Wie kann man deren Störung, die sie auf ihren Kanälen erfolgreich verbreiten, wiederum stören – in Bild und Ton? Wie kann man der neurechten Metapolitik, wie es oft genannt wird, einen Riegel vorschieben? Das hätte auch am letzten Wochenende in Berlin passieren müssen, die Bilder des „Sturms“ auf den Reichstag hätten verhindert werden können. Ich denke nicht, dass Theater diese Störung ästhetisch framen und damit neutralisieren können. Als „Keine Bühne“ haben wir dann offene Briefe veröffentlicht, vor allem gegen die Einladung von Rechtsextremen zu Podiumsdiskussionen in Kultureinrichtungen.
Waren solche Störaktionen der künstlerische Impuls, ein Stück über antifaschistischen Widerstand zu schreiben?
Ich habe nach dem G20-Gipfel angefangen, mich zu fragen, wie es heute um die radikale Linke steht und wie sich die Antifa zusammensetzt. Dabei wollte ich einen Bezug zum Kapp-Putsch von vor hundert Jahren herstellen. Gibt es eine antifaschistische Unterströmung? Gibt es einen politischen Kern? Die Antifa ist heute zweifellos pluraler und diverser geworden als zu Zeiten der autonomen Antifa in Städten wie Göttingen und Frankfurt in den 1980er Jahren. In Bewegungen wie „We’ll Come United“ sieht man eine Antifa, die sich auch mit einer Migrantifa und selbstorganisierten Geflüchteten verbunden hat. Mich hat auch sehr interessiert, wie sich die Frage nach Bündnissen mit zivilgesellschaftlichen Akteur*innen wandelt.
Die sogenannten „Neuen Rechten“ nehmen die Institution Theater immer mehr ins Visier. Warum?
Wenn man sich zum Beispiel das Buch von Björn Höcke anschaut, „Nie zweimal in denselben Fluß“, es richtet sich dezidiert an ein bürgerliches Publikum. Dabei schöpft er seinen ganzen bildungsbürgerlichen Zettelkasten aus. Sein Hauptadressat ist der Mittelstand, auch wenn er der Arbeiterschaft in den Betrieben eine Querfront anbietet. Und dazu gehört natürlich auch das Theater und die Kultur. Um rechtes Theater ist es schlecht bestellt. Es gibt da einen Aufholbedarf – und das ist Teil dieser neurechten Metapolitik, Hegemonie zu erlangen. Da ist dieser Gramsci-Topos, den die Neurechten kapern. Diese kulturpolitische Achse bietet den Neurechten auch eine Möglichkeit, weg von der Straße zu kommen und weiter in die Mitte der Gesellschaft hineinzudringen.
Es gibt nur wenige antifaschistische Theaterstücke. Finden Sie Theater in dieser Hinsicht zu apolitisch?
Das kann ich gar nicht so quantifizieren, ob es zu wenige gibt. Es gibt sicher mehr linkes Theater als rechtes Theater. Ich habe aber eine Dringlichkeit gesehen, ansonsten hätte ich das Projekt nicht gemacht. Mich hat vor allem die Frage interessiert, warum ist das historische Bündnis der demokratischen Parteien in den 1920er und 1930er-Jahren zu schwach gewesen und was lernen wir heute daraus? Warum gab es keine Einheit zwischen KPD und SPD? Und was erinnert auch heute noch an die damaligen Grabenkämpfe? Dieser Frage wollte ich im Stück nachgehen und dagegen eine unteilbare Antifa setzen.
Wie stellen wir uns das Stück vor?
Ich habe das Stück für den Gorki-Hausregisseur Sebastian Nübling und ein diverses Ensemble geschrieben. Ich bin auf die Inszenierung auch selbst gespannt, ich war bisher nur bei ein paar Proben dabei. Für das Stück habe ich mit vielen Antifaschist*innen gesprochen und O-Töne gesammelt. Ich wollte ihren Jargon unverfälscht auf die Bühne bringen. Ich wollte aus der Bewegung heraus sprechen. Das Stück ist eine Collage an Positionen. Dabei ist Montage auf jeden Fall ein wichtiges ästhetisches Prinzip. Ich habe mir die Leningrad-Symphonie von Schostakowitsch genommen und das Stück nach den vier Sätzen darin strukturiert. So entsteht eine Art Partitur aus vielen Stimmen, die immer in neuen Konstellationen auftreten – auf der Suche nach einem antifaschistischen „Wir“, das noch nie so plural gewesen ist wie jetzt. Es stellt dabei das cis-männliche, weiße „Wir“ der Antifa früherer Jahre radikal in Frage.

Im Ankündigungstext wird Antifaschismus als ein Sisyphos-Projekt über 100 Jahre Geschichte beschrieben. Das klingt doch ziemlich pessimistisch.
Das waren nicht meine Worte. Aber ein Sisyphos-Projekt ist es vielleicht deswegen, weil es mühsam ist und es dafür keine bürgerliche Anerkennung gibt. Die muss man sich selber schaffen. Wenn man bedenkt, welchen massiven Repression die Antifa schon immer ausgesetzt war, ist der Sisyphos-Vergleich sogar noch zu schwach. Von den 1920er Jahren bis heute gibt es immer wieder Tote unter denjenigen, die sich antifaschistisch organisieren. Menschen, die sich den Faschisten in den Weg stellen sowie Menschen, denen sich die Faschisten in den Weg stellen. Für all diese Opfer habe ich diesen Erinnerungstext geschrieben. Ein Vorwärts gibt es nur ohne Vergessen.
Der Titel „Schwarzer Block“ bezieht sich auf keine spezifische antifaschistische Gruppe, sondern auf eine Demotaktik, die u.a. auch von nationalistischen Autonomen verwendet wird. Der Begriff ist medial und politisch sehr aufgeladen. Warum haben Sie diesen provokativen Titel gewählt?
Für mich ist der „schwarze Block“ schon eine Antifa-Strategie, die durch ein Erscheinungsbild eine kollektive Agenda behauptet. Ich habe auch ganz konkret historisch nachvollzogen, wo dieser schwarze Block zum ersten Mal in Erscheinung getreten ist – und zwar mit den „Schwarzen Scharen“, eine anarcho-syndikalistische Gruppe, die sich Anfang der 1930er Jahre gegründet hat. Und der Block damals war gar nicht so homogen. Es war eine kleine, marginale Bewegung zwischen den viel größeren Straßenkampforganisationen der KPD und der SPD.
„Schwarzer Block“ taucht immer wieder als rechter Kampfbegriff auf, um antifaschistische oder linke Proteste zu diskreditieren und delegitimieren. Hinzu kommt, dass viele Antifaschist*innen sich mit dem Begriff gar nicht identifizieren können. Auch einige postautonome linksradikale Gruppen haben sich mittlerweile von der Strategie des „schwarzen Blockes“ abgewandt, da diese überhaupt nicht anschlussfähig sei. Ist der Begriff dann doch nicht zu militant?
Dieses Problem bin ich im Stück frontal angegangen. Natürlich ist diese Demotaktik eine unter vielen. Beim G20-Vorbereitungstreffen im Kreuzberger „SO-36“ hieß es: „Zu bunt gehört auch Schwarz“. Ich hätte natürlich auch einen bunteren, inkludierenderen, pluraleren Titel wählen können. Für manche steht der schwarze Block heute nicht mehr für Angriff, sondern Luftangriff. Bei „Welcome to hell“ in Hamburg war der „schwarzer Block“ als großer aufblasbarer Würfel zu sehen. Es gibt inzwischen auch grüne, lila oder weiße Blöcke. Nichtsdestotrotz beschäftigt mich dieses Thema der Massenmilitanz, ihre Rechtfertigung und ihre roten Linien. Wenn man sich die inklusiveren Erfolge – wie „Dresden nazifrei“ 2011 – anschaut, dann wurden 5000 Nazis blockiert, nicht weil es eine Lichterkette oder ein Händchenhalten gegeben hätte, sondern weil massiv ziviler Ungehorsam und Blockaden stattgefunden haben. Und auch Leute aus der bürgerlichen Mitte, die gegen Nazis demonstriert haben, von der Polizei als störend empfunden wurden. Darüber müssen wir reden. Vor allem vor dem Hintergrund, dass in den Reihen der Polizei und Bundeswehr immer mehr Rechtsextreme beheimatet sind. An wen wende ich mich denn, wenn ich bedroht werde und mein Vertrauen schwindet? Wer verteidigt die Demokratie, wenn die Verantwortlichen nur Einzeltäter, keine Netzwerke ausmachen?
Das könnte als eine Art Zelebrierung linker Militanz konstruiert werden…
Nein, es ist eine Problematisierung, aber eine konstruktive Problematisierung.
Wir freuen uns auf die Premiere. Vielen Dank für das Gespräch.